Nach dem Koma
„Mein langer Weg zurück ins Leben“

Einige Damen und Herren des Reha-Teams im NRZ. Ehrlich, alle waren hochmotiviert und engagiert, wollten nur das Beste für ihre Patient*innen. Zu meinen Maßnahmen gehörten: Laufband, Fahrrad, Gruppenspiele, Peddigrohrflechten, Fitnessgeräte, Thai Chi, Ballspiele, Gleichgewichtsübungen, motorisches Training und Feinmotorik. Tatsächlich war ich den ganzen Tag beschäftigt und abends fix und fertig. Foto/Copyright: Viktoria Kühne
Endlich allein. Seit meinem Erwachen aus dem künstlichen Koma sind einige Stunden vergangen. Eben hat die letzte Schwester das Zimmer verlassen, nachdem sie mir noch einen Tropfen Blut aus dem Ohrläppchen abgenommen hat. Ich versuche, meine Gedanken zu sortieren. Aber das klappt nicht. 35 Tage und Nächte habe ich nichts vom Leben mitbekommen, mich in anderen Welten bewegt. Meine Frau fragte mich Wochen später, ob ich denn „wirklich nichts gespürt habe?“ „Nein!“, lautete meine schlichte Antwort. Kein Streicheln, kein Massieren der Beine, kein Waschen, kein Kämmen – nichts.
Ich war in den anderen Welten unterwegs…
Diese Erlebnisse werden in den kommenden Wochen immer wieder auftauchen. Meistens nachts.
So war es auch in den ersten Stunden nach dem Aufwachen. Eigentlich will ich schlafen, aber da sind sie wieder, diese Bilder: Billardkugeln, mittelalterlicher Marktplatz, dazu unbeschreiblicher Lärm, der mein Gehirn überschwemmt. Noch erkenne ich nicht alles. Es ist wie bei einem Digitalfernseher, bei dem die Übertragung nicht klappt: Die Bilder sind total verpixelt, nur ab und zu ist etwas klar zu erkennen.
Dann dieses Ungewissheit: Was war los in den letzten Wochen?
Warum kann ich mich an nichts erinnern?
Wie geht es weiter?
Werde ich je wieder gesund?
Dazu kommt: Ich kann mich kaum bewegen. Vier Kanülen in den Lenden. Ebenso in den Armen. Ein Katheter. Clipse an den Fingern, die Herzfrequenz und den Puls messen. Ein Nasenschlauch für die Nahrung. Überall pocht es.
Zwischenzeile: „Sie brauchen Geduld – viel Geduld“
Es ist unerklärlich, aber mit dem Aufsteigen der kalten, blassen Novembersonne kehrt auch mein Kampfeswillen zurück: Ich will wieder gesund werden und zurück ins Leben. Dafür werde ich alles tun.
Als Stunden später Oberarzt Tobias Leis zu mir kommt, um mich darüber zu informieren, wie es weitergeht, höre ich zwar aufmerksam zu, aber eigentlich interessieren mich ganz andere Dinge: Wann kann ich aufstehen? Wann beginnt das Lauftraining. Wann wird das Atemgerät entfernt? Mein behandelnder Arzt macht mir schnell klar, dass ich Geduld brauche. „Viel Geduld!“
Lächelnd denke ich an den Spruch: Herr, bitte gib mir viel Geduld. Aber ein bisschen plötzlich!
Zwei Tage später: Ich möchte gern einige Stunden in einem Stuhl sitzen. Obwohl Doktor Leis das für zu früh hält, stimmt er zu: „Ich denke, das schaffen Sie.“
Am nächsten Tag ist es so weit: Physiotherapeut Christian und eine Schwester schieben den Stuhl ans Bett und fordern mich grinsend auf, mich doch reinzusetzen.
„Ich werde es ihnen zeigen“, nehme ich mir vor, muss aber schnell erkennen: Zwischen Wollen und Können liegen Welten. Kurz gesagt: Ich kann nicht. Christian und die Schwester wollen, ich werde in den Stuhl gehievt. „Erster Erfolg“, verbuche ich auf dem Weg ins Leben. Mein besorgter Arzt ist erleichtert, dass das Experiment geklappt hat. Ich selber bin erleichtert, dass ich nach dreistündigem Sitzmarathon endlich wieder ins Bett gelegt werde und schlafe erschöpft ein. Vielleicht ist es dieser kleine Sieg, denn aus den verpixelten Bildern werden kleine Filme, so dass ich anfangen kann, Erinnerungen aus den Komawelten abzurufen.

Die Intensivstation in Lostau: Doktor Maria Stein, spricht mit einem Pfleger. Frau Stein hat die Lungenklinik mittlerweile verlassen. Der Eindruck auf dem Foto täuscht: Normalerweise ist es auf einer Intensivstation nie so ruhig. Das merkte ich, als ich aus dem Koma erwachte und den Stationsalltag miterlebte. Überall bimmelte und klingelte es, laute Stimmen hallten über den Flur und ständig herrschte mal angenehmer, mal unangenehmer Trubel. Besonders nachts! Foto/Copyright: Viktoria Kühne
Aber mit anderen darüber zu sprechen, erscheint mir noch zu früh. Es geht auch nicht, denn in der Trachealkanüle sitzt ein kleiner Ballon, der aufgepumpt wird, damit keine Fremdkörper in die Luftröhre eindringen können. Ist der Ballon gefüllt, ist Sprechen unmöglich. Erst später werde ich stundenweise vom „Ballon genommen“, bekomme ein Sprachmodul auf die Kanüle gesetzt und darf „losquatschen“. Was die Kommunikation auch erschwerte: Leserlich zu schreiben ist nicht meine Stärke. Auch meine Sätze ins Handy zu tippen, klappte nicht: Ich konnte meine Finger nicht koordinieren – ich tippte Wörter, die es gar nicht gibt.
Zwei Tage nach dem gelungenen „Sitz-Experiment“ überrascht mich Physiotherapeut Christian: „So, jetzt versuchen Sie mal, zu laufen.“ Meine ohnehin schon wackeligen Knie werden noch wackeliger. Ich knete meine Oberschenkel. Nichts. Alles eingeschlafen. Fast zehn Minuten dauert es, bis Christian mich abgekabelt und die Leitungen der Kanülen verlegt hat. Dann schließt er mich an eine Sauerstoffflasche an, und stellt mich vor den Rollator: „Auf geht’s.“
Na, der hat gut reden: Ich weiß überhaupt nicht mehr, wie Laufen geht. Mühsam schiebe ich ein Bein vor, klammere mich an den Rollator und bin tatsächlich ein Stück vorangekommen. Unendlich langsam nähere ich mich der Zimmertür, meiner Pforte zur Außenwelt. Endlich ist es geschafft: Ich rolle gehend auf den Flur. Ich kehre in die Welt zurück…
Zwischenzeile: Erster Fortschritt: Immer mehr Kanülen werden entfernt
Doktor Leis bewilligt mir ein Bett-Fahrrad, ich träume von einem Laufband im Zimmer. Aber ich bin ihm sehr dankbar, denn nun kann ich auch ohne Physiotherapeuten trainieren. Also strampele ich, wann immer es geht, im Bett mit dem Fahrrad. Erst langsam und kurz, dann länger und schneller.
Auch meine Heilung scheint Fortschritte zu machen, denn immer mehr Kanülen verschwinden: erst in den Lenden, der Katheter. Dann endlich werde ich vom Atemgerät genommen und atme eigenständig mit der Trachealkanüle, die vor Wochen eingesetzt und fest vernäht wurde.
Zur Erklärung: Unsere Gesetze schreiben vor, dass bei Patienten, die ins künstliche Koma versetzt werden, diese Kanüle vernäht werden muss und nach Genesung wieder operativ entfernt wird. Wenn alles gut geht.
Zwei Wochen bleibe ich auf der Intensivstation, quäle mich durch die Nächte, absolviere meine kleinen Übungen am Tage und werde durch den Nasenschlauch ernährt. Die ersten Schritte zurück ins Leben sind gemacht. Nun wartet die nächste Hürde auf mich: das Neurologische Rehabilitationszentrum in Magdeburg (NRZ).

Monate nach meiner Reha erklärte mir Tobias Leis noch einmal ganz genau die Bedeutung einer Trachealkanüle. Unglaublich, dass so ein kleines, geschwungenes und durchsichtiges Plastikteilchen über Monate mein Leben bestimmen konnte. Nicht zu vergessen der Ballon, der meine Luftröhre blockierte und das Sprachmodul, mit dem ich mich stundenweise artikulieren konnte. Ohne das Modul blieb ich stumm, 21 Stunden am Tag – und das mir! Aber meine Umgebung hat sich sicherlich gefreut. Foto/Copyright: Jörg Böthling

Dieses Foto steht ganz oben, denn Birgit Schindelhütte, meine Logopädin im NRZ, wurde für mich zur wichtigsten Therapeutin. Sie machte mir Mut und gab mir Kraft, wenn ich daran verzweifelte, dass mein Kehlkopf nicht nach oben flutschen wollte. Am Ende der Therapie sagte sie zu mir: „Ich hätte nicht gedacht, dass Sie es so schnell schaffen. Ich hatte mit zwölf Monaten gerechnet. Aber Sie haben geübt und geübt. Deshalb ging es so schnell.“ Foto/Copyright: Viktoria Kühne
„Wie wecke ich einen eingeschlafenen Kehlkopf auf?“
Ich ziehe eine erste Bilanz: Ich kann 45 Schritte laufen, schaffe zwei Treppen. Meine Medikamentendosis wurde herabgesetzt und mein Kopf wird klarer.
Lesen geht für einige Minuten, Notizen am Laptop dauern lange. Meine Hände sind noch schwach und zittrig.
Drei Stunden am Tag darf ich mit meinem Sprechmodul sprechen, für die restlichen 21 Stunden bleibt die Kanüle blockiert und ich bin zum Schweigen verdammt. Schlucken geht noch gar nicht.
Während alle anderen Muskeln bereits mit mir unterwegs sind, schlafen alle die Bereiche, die beim Menschen dafür sorgen, dass die Nahrung vom Mund in den Magen gerät.
Mein Kehlkopfdeckel ist seit dem Koma unbeweglich, öffnet sich nicht und geht auch nicht wieder zu. Fürs Schlucken ein unerlässlicher Vorgang, denn der Deckel vermeidet, dass Essen in die Luftröhre kommt und sich in der Lunge ablagert. Würde das passieren, wäre das nächste Koma programmiert.
Fitness und Kondition sind trainierbar. Aber Essen und Trinken?
„Schlucken ist ein unbewusster Reflex“, erklärt mir Tobias Leis, „das müssen Sie sich jetzt wieder antrainieren. Ich bin zuversichtlich, Sie schaffen das.“ Wie lange das allerdings dauern wird, kann er mir auch nicht sagen.
Ich lernte sogar Flechten mit Peddigrohr.
Eine Zukunft ohne Essen und Trinken, dafür mit künstlicher Nahrung und Wasser über die Magensonde (die mir in der Reha gelegt wird) – das macht mir Angst. Deshalb weigere ich mich, mich damit zu beschäftigen.
Es ist Freitag, der 17. November 2017, an dem ich im Neurologischen Rehabilitationszentrum Magdeburg eingeliefert werde.
Was bedeutet, übers Wochenende tut sich nichts: „Bei uns verläuft alles etwas ruhiger und braucht seine Zeit“, erklärt mir Dr. Stefan Kley, der mich in den nächsten Monaten betreuen wird.
Auch Schwester Romy, sie leitet die Station, begrüßt mich freundlich und erklärt alles Wesentliche. Nach dem Wochenende beginnen die Eingangsuntersuchungen der Physiotherapeuten, Ergotherapeuten und Logopäden.
Die ersten Maßnahmen werden festgelegt. Ich stimme allem zu, bitte sogar, mir jedwede mögliche Behandlung zukommen zu lassen: „Ich bin nicht hier, um mich auszuruhen, sondern um gesund zu werden“, sage ich. Das sorgt zwar für Staunen, aber es kommt an. In den nächsten Wochen füllt sich mein Terminplan so sehr, dass ich nicht mehr über Langeweile klagen kann.
Ich liege im vorletzten Zimmer auf der Station 12. Von hier sind es gut 150 Meter bis zur Treppe mit 26 Stufen ins Erdgeschoss. Dann sind je nachdem 200 bis 400 Meter zu den Therapieräumen zurückzulegen. Anfangs hangele ich mich an den Geländern entlang, um überhaupt die Strecken zu schaffen. Aber ich habe es geschafft.
Auch meine Therapieeinheiten gehe ich optimistisch an: Laufband, Ergometer, Yoga, Ball- und Bewegungsübungen in der Sporthalle – ich verpasse nichts und mache mit.
Woche für Woche wurde mein Therapieplan um eine Maßnahme erweitert: Dabei nahmen Peddigrohrflechten, Kneten und Reaktionsübungen am Computer eine ganz wichtige Rolle ein. Hätte mir vor meiner Erkrankung jemand gesagt, ich würde eines Tages einen Korb (er hat mittlerweile einen „Ehrenplatz“ bei uns daheim) aus Peddigrohr flechten, hätte ich nur müde gelächelt.
Aber dadurch wurden meine abgeschlafften Finger wieder fit. Auch das Arbeiten mit Therapieknete lohnte sich, half es doch, die Gelenke der Hände zu stärken.
Tatsächlich waren überall Fortschritte zu erkennen und es ging ständig nach vorn.
Nur beim Schlucken tat sich in den ersten Wochen absolut nichts. Das hatte Folgen.
Da war zum einen das Blockieren der Trachealkanüle. Es war klar, solange ich nicht schlucken kann, wird das lebensrettende Röhrchen nachts blockiert.
Das bedeutete aber auch, dass ich unter massiven Hustenkrämpfen und Atemnot litt. Ich hatte panische Angst zu ersticken, spuckte, keuchte und hustete. Und wollte schreien. Aber das ging ja nicht.
Die Trachealkanüle hatte sich von einer Lebensrettung zur Todesfalle gewandelt. Ich würde ersticken! Ein Teufelskreis.
In letzter Verzweiflung drückte ich den Alarmknopf. Oft alle zehn Minuten. Glücklicherweise ertrugen es die Schwestern und Pfleger im Nachtdienst mit Freundlichkeit und großer Gelassenheit. Sie eilten zu mir, saugten das Sekret ab, richteten mein Bett und verließen mich mit Gute Nacht-Wünschen.
Das nützte leider wenig, denn meine traumatischen Koma-Erlebnisse beschäftigten mich auch hier und ließen mich nicht zur Ruhe kommen. Sicher, ich wusste, was mir diese Erfahrungen sagten. Aber würde ich tatsächlich auch meine Lehren daraus ziehen und mein Leben umstellen? „Der Geist ist willig, das Fleisch ist schwach“, flackerte es immer wieder in meinem Hirn auf.


Mein Laufbandtraining begann mit fünf Kilometern und fünf Minuten. Danach war ich fix und fertig, schaffte es kaum noch ins Bett. Aber, von Tag zu Tag wurde es besser, die Zeiten länger, die Geschwindigkeit gesteigert. Auf dem Band begriff ich, dass eine Therapie nur Erfolg hat, wenn man a) mitmacht und b) kontinuierlich dabeibleibt. Gut 150 Meter lang war der Flur auf der Station im NRZ. Ich hatte das vorletzte Zimmer ganz links. Anfangs war es für mich bis zum Schwesternzimmer eine ziemliche Qual. Später habe ich mir überlegt, wie oft die Pfleger*innen jeden Tag hier rauf- und runterlaufen. Schnell verschwand mein Selbstmitleid und verwandelte sich in Mitleid für das Personal. Foto/Copyright: Viktoria Kühne
Dreimal in der Woche kam Birgit Schindelhütte auf mein Zimmer. Ehrlich, eine ausgezeichnete Logopädin. Ihre Aufgabe: Mich von meiner schweren Dysphagie, also den Schluckbeschwerden, zu befreien. Dafür trainierte sie mit mir das sogenannte Masako- und das Mendelsohn-Manöver. Nein, das sind keine Kriegstaktiken, sondern Übungen, die den Kehlkopf veranlassen sollen, sich zu heben oder zu senken.
Dazu kamen Sprachübungen mit 3-silbigen Wörtern, die ein „NG“ oder „NK“ erhielten. „Es nützt aber nichts, wenn Sie nur während meiner Anwesenheit üben. Sie müssen das trainieren, jede Übung mindestens dreimal am Tag. Sonst wird das nichts.“ Um meinen Leistungsstand zu kontrollieren, brachte Beate Schindelhütte regelmäßig mit Lebensmittelfarbe versetztes Essen mit. So konnte überprüft werden, ob sich der Kehldeckel über der Luftröhre schloss, und das Essen über die Speiseröhre in den Magen transportiert wurde oder sich den tödlichen Weg über die Luftröhre in die Lunge suchte.
Gut einen Monat nach dem Beginn meiner logopädischen Übungen (glauben Sie mir, ich habe geübt und geübt und geübt) stand eine sogenannte Laryngoskopie auf dem Programm. Dabei wird eine Kamera durch die Nase eingeführt.
Ihre Aufgabe: Bilder rund um den Kehlkopf zu senden. Senkt er sich? Hebt er sich? Kann ich schlucken? Habe ich Fortschritte durch mein Training gemacht?
Das Ergebnis war verheerend.
Nichts ging. Essen blieb hängen. Das Schlucken glich noch nicht einmal im Ansatz dem uns bekannten Schlucken. Und aus der Trachealkanüle floss blaue Lebensmittelfarbe.
Das Training hatte nichts gebracht. Und dann hob sich plötzlich der Kehlkopf …
„Sie müssen Geduld haben. Das kann lange dauern. Aber wir schaffen das“, versuchte mich Birgit Schindelhütte zu trösten.
Auch Doktor Lenz, der bereits bei meiner Rückkehr aus dem Koma mitgeholfen hatte, strahlt Optimismus aus: „Lassen Sie sich von diesem Zwischenbefund nicht irritieren.“
Die beiden hatten gut reden. Ich war verzweifelt: Nur noch Magensonde? Nie wieder ein Glas Wein? Keine Kartoffeln, kein Salat? Ausschließlich Chemie im Bauch.
Ich flehte den lieben Gott an, mich nicht allein zu lassen, hatte er mich doch schon so weit gebracht. So weit, dass meine Selbständigkeit auf der Station von Tag zu Tag wuchs. Und jetzt dieser Rückschritt, wie ich meinte.
Doch dann machte es plötzlich Klick im Kopf und eine „Erinnerungs-Koma-Schublade“ sprang sperrangelweit auf: In ihr die Botschaft, dass ich ein neues Leben bekomme, damit ich Dinge geraderücke, die schiefgegangen waren. „Nutze die Chance“ spürte ich.
Und ich trainierte. Wann immer es ein Zeitfenster gab, standen logopädische Übungen auf dem Programm.
Der Durchbruch kam Anfang Dezember, als ich gerade mal wieder das Masako-Manöver durchführte. Der Kehlkopf hob sich an.
Was für ein Gefühl. Was für ein Erlebnis.
Von nun an durfte ich kleine Portionen Kartoffelbrei, Suppe oder Joghurt verputzen. Kleine Portionen, das bedeutete, einen Teelöffel voll. Dann zwei. Dann drei, und, und, und… Plötzlich geht es bergauf. Ich werde fitter und fitter. Der Kehlkopf bewegt sich immer mehr und Dr. Kley erlaubt mir über Weihnachten tagsüber auf „Heimaturlaub“ zu gehen. Was für ein Geschenk.
Nach drei Monaten darf ich zum ersten Mal nach Hause!
Der Rest ist schnell erzählt: Während der Festtage bin ich von morgens bis abends bei meiner Familie. Wir schmieden Zukunftspläne …
Mit viel Liebe hat meine Frau Kleinigkeiten für mich zubereitet, die ich neben meiner künstlichen Nahrung essen darf: etwas Kartoffelbrei, eine Suppe, Gemüse. Für mich ist jeder kleine Happen ein Festmahl. Jedes Kauen, jeder Schluck ist ein Geschenk Gottes. Ich bin dankbar. Dankbar, weil Gott bei mir geblieben ist und mir eine Chance gegeben hat.
Nachtrag:
Nach Weihnachten 2017 ging alles sehr schnell. Anfang Januar wurden mir die Trachealkanüle und die Magensonde entfernt. Seitdem ernähre ich mich wieder komplett allein. Nicht immer einfach, aber ich mache Fortschritte von Tag zu Tag.
Apropos Tag: Jeder ist für mich ein neues Erlebnis, ein demütiges Staunen und Verinnerlichen der unglaublichen Schöpfung … Auch wenn ich ständig meinen Kehlkopf und die Muskeln im Mundbereich trainieren muss und nur ganz langsam kauen darf.
Vieles hat sich seit meinem künstlichen Koma geändert: Familie ist mir wichtiger als Arbeit. Zeit für mich hat Vorrang vor allen Terminen. Demütig lebe ich besser als mit Macht. Mein restliches Leben gehört meiner Frau, meiner Familie und allen Menschen, denen ich helfen kann.
Meine Zeit im Neurologischen Zentrum Magdeburg: Doktor Ron Lenz, hatte bereits an meinen Augen gesehen, dass ich leben wollte und betreute mich im NRZ. Der lange Flur – ich weiß nicht, wie oft ich ihn in mehr als zwei Monaten gelaufen bin. Dr. Stefan Kley war der Stationsarzt und erlaubte mir Weihnachten 2017 die Klinik tagsüber zu verlassen. Ich hasse eigentlich Training an Maschinen, aber für den Muskelaufbau war es unerlässlich. Das Laufband dagegen war absolut meins. Oft habe ich dreimal am Tag meine „Runden“ gedreht. Gleichgewichtstraining – der Horror. Es dauerte Monate bis ich das einigermaßen im Griff hatte. Ganz ehrlich: Noch heute fällt es mir schwer auf einem Bein zu stehen. Endlich wieder eigenständig essen. Die Cafeteria im NRZ war für mich – nachdem mir Magensonde und Trachealkanüle gezogen worden waren – wie ein Gourmetrestaurant. Das Essen dauerte zwar lange, aber ich war glücklich über jeden Brocken, der in meinem Magen landete und nicht ausgehustet wurde. Sobald es wieder einigermaßen ging, bestand ich darauf, mein Bett selber zu machen: „Ich bin doch nicht schwach und kränklich“, war mein Argument. Die Schwestern nahmen es mit einem Lächeln. Alle Fotos/Copyright: Viktoria Kühne
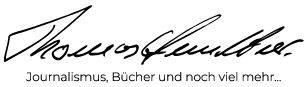








Hinterlasse einen Kommentar