Iso Camartin
„Wir brauchen wieder mehr Mut für unsere Sprache“

Iso Camartin wurde am 24. März 1944 in Chur in der Schweiz geboren. Er wuchs in Disentis auf, wo er die Klosterschule der Benediktiner besuchte. Nach der Matura studierte er ab 1965 in München, Bologna und Regensburg Philosophie und Romanistik. Sechs Jahre später promovierte Iso Camartin über die Philosophen Immanuel Kant und Johann Gottlieb Fichte.
Als Publizist, Schriftsteller und Fernsehmoderator wurde Iso Camartin weit über die Schweiz hinaus bekannt, arbeitete unter anderem als ordentlicher Professor an der Universität Zürich oder am Wissenschaftskolleg in Berlin. Er ist Mitglied der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung. Für seine Arbeiten erhielt Iso Camartin zahlreiche Auszeichnungen, darunter 1998 den Johann-Heinrich-Merck-Preis für literarische Kritik und Essay. In der Begründung heißt es: „Iso Camartin empfiehlt das selten Bedachte der Aufmerksamkeit und entdeckt das Wesentliche im Unauffälligen. Dank seiner Fähigkeit zur Analyse, dank der Eleganz seiner Sprache macht er den Leser hellhörig für Zusammenhänge, welche das Fremde wie etwas Vertrautes zur Anschauung bringen.“ Foto/Copyright: Mara Truog
Zu Iso Camartin kam ich wie die „Jungfrau zum Kind“ – durch einen falschen Buchstaben. Im Radio hörte ich, dass gerade von dem Schweizer Philosophen und Sprachkenner das interessante Buch „Die Kunst des Lebens“ veröffentlicht wurde. Da ich ständig auf der Suche nach Themen bin, bestellte ich ein Exemplar.
Vorher aber hatte ich das Thema bereits der Chefredakteurin der ehemaligen Stadtgottes angeboten. „Damit lässt sich bestimmt etwas anfangen“, sagte sie, „mach Dich schon mal schlau.“
Ich machte mich und musste schnell feststellen, dass ich die Buchstaben „e“ und „o“ verwechselt hatte. Doch nachdem ich die Texte in „Die Kunst des Lobens“ gelesen hatte, konnte ich guten Gewissens nach Zürich reisen, denn Iso Camartin ist ein vielschichtiger und interessanter Mann, der eine Menge zu sagen hat.
Vor dem Haus, in dem Iso Camartin eine große Wohnung mit Dachterrasse besitzt, traf ich mich am 11. November 2018 mit der Schweizer Fotografin, Mara Truog.
Kaum bei Iso Camartin angekommen, verfielen sie und Iso Camartin sofort ins Rätoromanische. Ich verstand natürlich kein Wort, erfreute mich aber an der herrlichen Sprachmelodie. Gut zwei Stunden dauerte das Gespräch, in einer wunderbar gemütlichen Umgebung: ein großer Wohnraum. Überall an den Wänden Ikonen, Gemälde, Holzschnitzereien und historische Steinfiguren. Meine Fotografin war besonders von einer ausgestopften Krähe angetan, die nahe eines Fensters stand. Auch ich musste den Vogel immer wieder anschauen – so als ginge eine magische Kraft von ihm aus …
Nach dem Gespräch führte uns Iso Camartin noch auf seine Dachterrasse und wir erlebten einen atemberaubenden Blick auf Zürich und den See.
Nach dem lehrreichen Gespräch erlebte ich noch einen herrlichen Nachmittag in Zürich und am See.
Wenige Tage später schickte mir Mara Truog eine Auswahl der Bilder, die sie von Iso Camartin aufgenommen hatte. Ich war beeindruckt, denn ihre Bildsprache und ihr untrüglicher Sinn für den Moment ließen die Fotos lebendig und intensiv erscheinen. Gern hätte ich noch öfter mit Mara Truog zusammengearbeitet. Leider ist es bisher nicht dazu gekommen.
Das Gespräch wurde im Mai 2019 in der ehemaligen Stadtgottes veröffentlicht.
Nun wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Lesen des Gesprächs mit einem feinsinnigen Philosophen.
Ihr ganzes Leben haben Sie sich mit Sprache beschäftigt. Was haben Sie von der Sprache gelernt?
Unsere Welt spiegelt sich in jeder Sprache wieder. Wir können ohne das Sprachliche nicht auskommen. Das bedeutet aber nicht, dass wir jede Sprache beherrschen müssen. Das ist natürlich unmöglich. Aber Sprache ist der verborgene Schatz für die Entdeckung des eigenen Ichs. Das ist der Unterschied zu Alternativsprachen, wie sie Tiere beherrschen. Selbstorientierung ist etwas, das zum Allerwichtigsten im Leben gehört – und sie verläuft über die Sprache.
Das setzt aber auch voraus, dass ich bereit bin, zu denken.
Ja. Unser Denken macht ebenso Fortschritte, wie die Sprachwahrnehmung – beides entwickelt sich mit dem Alter. Das ist ein spannender Prozess. Ich denke, Kinder empfangen von der Sprache das Musikalische. Wohlwollen oder Aggressivität, Gefahr oder Freude, all das empfangen die Kinder über die Tonlage der Sprache. Was das alles bedeutet, setzt eigentlich erst sehr viel später ein, wenn wir beginnen zu denken und zu lernen.
Warum unternehmen wir dann heute alles, um Sprache zu verhunzen, zu verkürzen, zu formatieren? Warum nehmen wir uns selbst das größte Verbindungselement weg?
Da die Sprache so viele Möglichkeiten beinhaltet, haben wir Menschen uns irgendwie damit abgefunden, dass es Sprache gibt im Alltagskleid für die einfachste Kommunikation. In unserer heutigen Zeit muss alles schnell gehen. Also verkürzen wir die Sprache, reduzieren, wo es nur geht. Die Kommunikation über die sozialen Medien vernachlässigt die Schrift und setzt verstärkt auf Symbole. Aus der Alltagssprache wird Zeichensprache. Gefühle werden durch einen Smiley ausgedrückt, anstatt beschrieben.
Deshalb ist es so wichtig, dass wir die Art der Sprache, die mehr ist als reine Verständigung, hegen und pflegen. Ich nenne sie die „Sprache im Festkleid“, die zum Verständnis und Begreifen führt.
Letztendlich ist Sprache ein Medium, das wir ständig selbst weiterentwickeln müssen.
Wie?
Nehmen wir die Befehlssprache. Wenn ein Vorgesetzter beim Militär einem Untergebenen sagt, was er zu tun hat, macht es keinen Sinn, mit ihm in einen Dialog zu treten.
Ganz anders dagegen, die Sprache der Intimität. Das ist etwas Wunderbares. Sie vermittelt Zugehörigkeit zur Familie, zu Verwandten ist also nur für einen kleinen Kreis. So bleibt Sprache lebendig und entwickelt sich weiter. Wir müssen nur den Mut haben, uns auch im Verkehr nach außen an diese Sprachmöglichkeit zu erinnern.
Wenn ein Schriftsteller schreibt, wie andere es bereits getan haben, sollte er eigentlich unzufrieden mit sich sein. Und zugeben: „Ich bin zwar gut in der Adaptation, ich kann mich anpassen, ich kann lernen, ich kann nachahmen, aber ich kann nicht unverwechselbar schreiben.“
Das erklären Sie bitte.
Gern. Vor Jahren habe ich mit einem Freund darüber gesprochen, welche literarischen Texte wir immer greifbar haben wollten. Später, kurz vor seinem Tod, sprachen wir wieder darüber. Er erinnerte sich an unser früheres Gespräch und meinte: „Jetzt bin ich doch nicht sicher, ob der Satz, den man am Ende in Erinnerung halten will, von Proust oder von Theodor von Fontane sein sollte. Vermutlich ist es wohl ein Satz, den ich selbst geschrieben habe.“
Das ist eine interessante Art des Selbstverständnisses und der Individualisierung unserer Ansprüche und Vorstellungen.
Nehmen Sie einen Lyriker. Seine Kunst ist es, eine Kombination von Gedanken und Wörtern zu finden und mit einem eigenen Sound zu verbinden. Wenn der Leser des Gedichtes dann sagt: „So habe ich das noch nicht gelesen“, dann handelt es sich wohl um einen guten Lyriker.
Sie sagen, es gibt keine Politiker mehr, die eine beeindruckende Rede halten können. Legen wir keinen Wert mehr auf Sprache?
Sie haben recht: Die zentrale Frage ist, welches Bedürfnis gibt es nach entwickelter Sprache, nicht in ihrer Schwundstufe, sondern in ihrer Vollstufe. Ich vergleiche es gern mit einer Orgel: Ich kann irgendein Register ziehen und bei diesem Register bleiben. Langweilig und eintönig. Oder ich versuche mit den unterschiedlichsten Registern, die Orgel zum Klingen zu bringen und sie so zum Leben zu erwecken.
Also ist das ästhetische Bedürfnis eines jeden entscheidend, sei er Politiker, Lehrer oder was auch immer. Ist es nicht beglückend zu erfahren: Ich rede anders als die Anderen?
Das deutsche Parlament hatte immer den Ruf, mit gedanklicher Schärfe und sprachlicher Präzision zu diskutieren und zu argumentieren. Helmut Schmidt, das war ein überragender Redner. Oder Franz Josef Strauß, Willy Brandt, Herbert Wehner oder Rainer Barzel. Das war eine große Politikergeneration.
Wenn ich dagegen heute Horst Seehofer höre, wie er zwischen „Ähs“ und „Stoßseufzern“ ringt und welche Unbeholfenheit er im sprachlichen Umgang an den Tag legt. Da muss ich ganz ehrlich sagen, die deutsche Sprachkultur hat sich stark verändert. Ich habe den Eindruck, dass politische Reden sich derart ritualisiert haben, dass sie kaum mehr für irgendjemanden ein Erweckungserlebnis bereithalten.
Es gibt aber auch andere Beispiele wie…
…ich weiß, Sie meinen Donald Trump. Aber er kommt von einer anderen Ebene, der skandalträchtigen. Er bringt es wirklich fertig, mit wüsten Unterstellungen, mit Verkürzungen und mit radikalem Verdrehen der Wahrheit, sein Aufmerksamkeitsspiel nicht nur zu spielen, sondern auch zu gewinnen. Da muss gegengesteuert werden. In den Künsten, aber auch in der Gegenrede. Die Gegenrede, das Entgegenhalten ist etwas vom Wichtigsten. Ich erlebe das jetzt in Amerika. Dort sind Intellektuelle, Prominente, Schriftsteller, Schauspieler, Musiker etc. dabei, eine Art Gegenkultur aufzubauen. Das ist ein interessanter Prozess.
Man muss diesem unmöglichen Trump sogar ein klein wenig dankbar sein, denn er hat auch etwas aufgedeckt: Seine Provokationen und seine empörende Haltung zu Fakten sind Mobilisationsmittel für die immer mehr werdenden notwendigen Gegenreaktionen. Ich hoffe nur, es wird möglich sein, diese anderen Möglichkeiten der Sprache so einzusetzen, dass der Umgang mit der Wahrheit wieder ins Licht der Neugier gerückt wird. Ansonsten verfallen wir einem kleinkarierten Aktionismus des Augenblicks und bedenken gar nicht mehr, dass wir von Personen wie Donald Trump nur noch das hören, was ihnen nützt.


Iso Camartin ist ein Mensch, der gern lächelt und lacht. Für ihn sind Höflichkeit, Zurückhaltung, freundlicher Umgang und friedliche Töne keine Fremdwörter. Dennoch hat er eine klare Meinung. Zum Beispiel über die Veränderungen in der Sprache und ob dies zulässig ist sagt er: „Sprache ist etwas, an dem man den Wandel, den unvermeidlichen Wandel, am allerbesten nachvollziehen kann. Sprache ist eine Art Indikator für den Zwang zum Wandel. Das ist interessant, ich erlebe das jetzt in einer scharfen Art. Gerade in den Kleinsprachen. Wir haben hier in der Schweiz eine Jugend, die heute ein völlig unbekümmertes Rätoromanisch sprechen. Sie packen Anglizismen und Germanismen hinein. Alles wird zu einem Gebräu, das zunächst nach einem Eintopf aussieht, in den alles reinkommt. Und dann taucht unter diesen jungen Leuten plötzlich jemand auf, der sagt: ‚Ich muss aus dieser Jugendsprache etwas Neues machen.‘ Eigentlich sind es nur die vorgestrigen Puristen, die sich darüber aufregen.“ Fotos/Copyright: Mara Truog
Barack Obama hat das wohl erkannt.
Stimmt. Seine Rede vor den Midterms-Wahlen im letzten November war sehr beeindruckend. Wie er in der Öffentlichkeit argumentiert und versucht, über die Sprache auch eine ethische Haltung mitzuliefern. Das ist beeindruckend. Ihm ist es nicht gleich, wie die Leute reagieren auf das, was er sagt. Er ist auch vermutlich weniger kalkulierend als es Trump ist mit seinen rüpelhaften Ausbrüchen. Aber da merkt man eben, was Sprache kann.
Ist Sprache Heimat?
Selbstverständlich. Es ist die Urheimat. Ein Beispiel: Für mich ist es immer ein großes Erlebnis, wenn ich nach China gehe. Ein interessantes, spannendes Land. Dort kommt man gut mit Englisch durch. Zumindest bei den Jüngeren. Aber China bleibt letztlich für mich unzugänglich, da ich kein Mandarin kann. So erfahre ich nie, was die Bewohner dieses Landes miteinander verhandeln. Ich weiß nichts von ihrem persönlichen Glück oder Unglück. Warum lachen die Menschen? Warum weinen sie? Da bleibe ich ein Ausgeschlossener. Ich kann nicht in die Herzen der Menschen vordringen. Darum ist verstandene Sprache, egal welche, immer Heimat. Ich bin fest davon überzeugt, jemand, der eine Liebe zur Sprache entwickelt, muss eine Art Sehnsuchtserfahrung nach dem Unverstandenen und Fremden in der Sprache gemacht haben.
Theodor W. Adorno hat das einmal wunderbar formuliert: „Fremdwörter sind Totenköpfe, die ihrer Auferstehung entgegenharren.“ Jetzt können wir fragen, was ist ein Fremdwort? Es kann eben nicht nur ein einzelnes Wort sein, sondern jedes Wort hat eine ganze Redekultur hinter sich. Hinter dem Fremdwort liegen die Erfahrungen, die manifestiert sind im Umgang der Menschen miteinander. Darum ist jede Sprache letztlich etwas Geheimnisvolles, kaum Erschließbares. Und der britisch-amerikanische Literaturprofessor George Steiner hat stets betont: „Jede Sprache und sei sie noch so eine kleine, unbedeutende Regionalsprache, ist ein anderes Fenster zur Welt.“ Und wenn diese Sprachen dahin sind, das war dann sein Schluss, dann ist das Fenster zu und es wird in der Welt dunkler.
Ich finde, das ist eine sehr schöne Überlegung, dass wir das Verstehen der Welt, nur über die Vielfalt der Kulturen, der Sprachen, auch der Musik und der Künste, erreichen können. Es gilt nicht nur zu bestaunen, sondern auch zu besprechen und zu erfahren.
Welche Gefahr birgt die Vereinfachung und Reduzierung der Sprache?
Populismus! Das ist eine Sprache, die jeder versteht. Populisten nehmen alles, was Sprache attraktiv und zu so einem wunderbaren Gebilde macht, weg und reduzieren es auf das Minimale. Die Folge: So wird ein Menschenverstand ins Spiel gebracht, der gegenüber differenziertem Denken, gegenüber Komplexität vermeintlich die Oberhand gewinnt. Aber das ist ein falscher Menschenverstand. Jürgen Habermas (ein deutscher Philosoph und Soziologe – die Redaktion) hat schon vor 30 Jahren von der neuen Unübersichtlichkeit gesprochen und das hat enorm zugenommen. Der Ruf nach klaren Verhältnissen, Übersichtlichkeit und Ordnung wird immer lauter. Alles was Störelemente sein könnten – Kritik, Differenzierung, Hinterfragen – wird potentiell als gefährlich und verdammenswert angesehen. Die Folge: Gesellschaften rücken nach rechts. Überall in Europa: Deutschland, Schweiz, Österreich, Frankreich, Italien, Polen, und, und, und. Es ist überall gleich.
Fällt Ihnen noch etwas ein?
Früher war alles besser. Diese ewige Diskussion um die Verherrlichung der Vergangenheit, um das Moderne zu verhindern. Das gab es schon immer. Selbst in ganz alten Dokumenten aus einer Schriftkultur finden sich immer Hinweise an der Kritik am Neuen. Aber warum? Es scheint ein merkwürdiges Zivilisationsbedürfnis zu sein, das Bessere hinter sich zu haben und nicht vor sich. Das halte ich für falsch, dieses Aufzeigen einer vermeintlichen Verfallskurve. Wir brauchen Entwicklung und den Blick nach vorne. Was hinter uns liegt, ist vorbei. Auch wenn wir zu wesentlichen Teilen in der Gegenwart davon leben.
Sprache ist auch ein Indiz eines zeitbezogenen Bedürfnisses. Aus alten Schriften können wir lesen. Wir finden nicht heraus, wenn Aristoteles einen Satz geschrieben hat, ob er an diesem Tag glücklich oder unglücklich war. Wir erfahren nicht, ob er Hals- oder Knieschmerzen hatte. Aber wir finden heraus, dass er in seiner Zeit eine Intention gehabt haben muss, diesen Satz zu schreiben. Dieses Intentionale ist etwas ganz Entscheidendes. Man braucht eine Vision, man muss eine Intention haben, die weitergegeben wird. Ein platonischer Dialog ist für uns geistig erfrischend und darum hochaktuell. Diese Art Frische, diese Art von Sprache zu erleben, ist etwas, das uns als kulturelle Schlafwandler aufweckt.
„Eine Gesellschaft, die nicht lobt, wertet nicht mehr richtig!“
„Eine Gesellschaft, die nicht lobt, wertet nicht mehr richtig!“

Warum Iso Camartin ein Buch über „Die Kunst des Lobens“ geschrieben hat? Hier seine Antwort: „Diese Form der Rhetorik hat mich einfach interessiert. Ich habe viele Lobreden geschrieben, ohne eigentlich über die Geschichte oder die Schwierigkeiten und über die Tradition der Lobrede genauer nachzudenken. Dann habe ich gedacht, so viele Menschen hast Du gelobt, das könnte doch auch ein Buch sein, wenn ich dazu eine Art historische Einführung mache, durch die die Leser dieses Thema verorten können.“ Foto/Copyright: Mara Truog

Iso Camartin hat die ganze Welt bereist. Seine Ehefrau, Melitta Schachner Camartin, die er auf einer Zugfahrt nach München kennenlernte, arbeitet als erfolgreiche Ärztin unter anderem in Amerika. Das Paar führt seit vielen Jahren eine Fernbeziehung: „Der Vorteil am Selbständig- und Ältersein ist, dass ich meine Zeit einteilen und allein bestimmen kann. So bin ich gern mal für einige Monate in Amerika, wenn sie einer ihrer vielen Gastprofessuren nachkommt. Oder sie kommt zu mir in die Schweiz, wann immer ihr es möglich ist. Dadurch sind wir eigentlich nicht so lange getrennt. Fest steht aber wohl, dass wir unseren Lebensabend in der Schweiz verbringen werden.“ Fotos/Copyright: Mara Truog
Wer hat denn in Ihren Augen heute Visionen?
Da fällt mir sofort der deutsche Philosoph Peter Sloterdijk ein. Er ist ein großer Spieler, der es schafft, über die Sprache Hellhörigkeit zu erwecken. Das was er sagt, mag nicht immer wahnsinnig originell sein. Nur wie er es formuliert, ist meistens überraschend und verjüngend. Der Leser bekommt den Eindruck, da will jemand uns über Spracharbeit, Sprachränder, Sprachverformung und Sprachentwicklung erreichen, uns aufmerksamer, hellhöriger und sensibler machen.
Ihnen ist das Lob zum ersten Mal in der Kirche begegnet …
… genau. Aber dazu möchte ich etwas ausholen.
Gern.
Die Kirchensprache ist eine weitere entscheidende Säule unserer Sprachen, neben der Arbeits-, Rechts- und Familiensprache. Kirchensprache steht für das Feierliche und ist wichtig für das Feierliche.
Nehmen wir den traditionellen Sonntag. Wir arbeiten nicht, sondern beschäftigen uns mit vielen anderen Dingen. Auch mit Religion. Es ist doch unglaublich, welcher Wortschatz aus der christlichen Tradition geflossen und bis heute verinnerlicht ist. Das reicht bis in unseren Alltag hinein. Die unzähligen Redewendungen. Die Psalmen oder die Bibelsprüche. Das sind geradezu in „Stein gemeißelte Formulierungen“, die gleichsam für die Ewigkeit gedacht sind. Die Geburt Christi, die Kreuzigung, die Wiederauferstehung. Gerade für die mystischen Glaubens- und emotionalen Bedürfnisse der Menschen waren die Religionen ein Sprachschöpfungsorgan erster Güte.
Nicht zu vergessen: Die Sprache der Kirche ist beinah immer mit Gesang verbunden. Das macht es gerade Kindern leicht, über die Stimme und über die Lieder einzelne Wörter vermittelt zu bekommen. Dadurch wird Sprache so etwas wie ein heimischer, vertrauter Bereich für sie.
Mein Vater arbeitete bei der Regionalzeitung, meine Mutter im Büro des örtlichen Notars. Es war völlig normal, dass ich, der ich ja nicht im Sommer auf dem Feld helfen musste, schon als kleiner Junge als Messdiener beim Pfarrer eingesetzt wurde. Glauben Sie mir, ich habe auswendig gelernt, zu ministrieren. Auf Latein! Tatsächlich konnte ich die Sprache der Ministranten, bevor ich lesen und schreiben lernte. Mit fünf habe ich angefangen auf lateinisch zu beten und diese Sprache, diese Art von präziser Sprache, die ist ganz tief in mich eingedrungen. Aber verstanden, was ich da gebetet habe, das habe ich erst sehr viele Jahre später im Gymnasium. Da merkte ich auch, welchen eigenen Charme und Zauber jede Sprache hat. Wunderbar war es in der Adoleszenz zu erleben, dass die schönste Art eine neue Sprache zu lernen ist, sich in ein Mädchen zu verlieben, denn gerade in diesem Gefühl sind die Geheimnisse der Sprache verborgen.
Ihre Lobrede „Die Zuversicht und das Leiden“ anlässlich des Todes von Papst Johannes Paul II. beginnen Sie mit einer bildkräftigen Metapher. Welche würden Sie für Franziskus wählen?
Ich kenne Franziskus nicht. Ich weiß nur das, was ich in der Presse über ihn gelesen habe. Mir scheint, es müsste etwas „Franziskanisches“ mehr als etwas „Jesuitisches“ sein. Vielleicht gäbe es dafür ja ein Bild in der Malerei. Lazarus, der die Brotreste bekommt vom Tisch der Reichen? Das wäre etwas, das ich direkt mit Franziskus verbinden würde. Vielleicht gäbe es auch in seiner Jugend etwas, um auf das Typische dieses Menschen zu stoßen. Was für mich feststeht: Franziskus ist keiner, der die Kirche im pompösen Festornat sehen will, sondern eine helfende Kirche sehen möchte. Auch dafür ließe sich vielleicht ein passendes Bild finden.
Warum haben wir das Loben verlernt?
Wir loben schon, denke ich. Vor allem staune ich manchmal, wenn ich Eltern mit Kindern höre, wie die ihre Kinder loben. Kinder brauchen Lob. Da sind wir uns einig. Kinder brauchen Ermunterung, sie müssen animiert werden, Mut zu sich selber zu fassen. Wenn ein Kind eine Zeichnung von einem Esel fertigt, und sie besteht nur aus drei- vier unbeholfenen Strichen, dann ist die Frage, ob man jetzt sagen soll: großartig, toll gemacht usw. Ich glaube, es braucht beim Loben eine Art von Begeisterung über das, was jemand kann. Wir brauchen dazu aber auch eine kritische Distanz. Sonst loben wir falsch. Die Frage ist also: Werden wir manchmal auch für falsche Dinge gelobt? Dinge, für die wir es weder verdient haben, noch die Sache es verdient hat.
Wir loben schon hin und wieder – nur die konventionellen Lobrituale sind uns abhandengekommen.
Müssen wir loben?
Ich glaube ja. Menschen brauchen Anerkennung. Die Anerkennung ist vielleicht die Grundsubstanz des Lobes. Man kann keine Lobrede halten auf jemanden, den man nicht anerkennt. Seine Leistung. Oder seine Persönlichkeit.
Die Menschen, die es schwer haben andere anzuerkennen, die haben es in der Regel auch schwer, sich selbst anzuerkennen.
Die Anerkennung muss nicht immer jubelnder Art oder laut sein. Es gibt auch Formen der inneren Anerkennung und Zustimmung. Ebenso gibt es innerliches Loben. Das ist das Gefäß, in das die Zufriedenheit mit dem Dasein hineinläuft. Lob ist eine nach außen gekehrte Form der bekennenden Anerkennung. Also des lauten Eingestehens, aber auch des dialogischen Anerkennens. Innerlich kann ich etwas auch anerkennen, allein dadurch, dass ich mich damit abfinde. Das wäre sozusagen die Minimalform der Anerkennung.

Für seine Werke und Essays wurde Iso Camartin mehrfach ausgezeichnet. Er erhielt unter anderem
1986 den Prix européen de l’essai Charles Veillon (Europäischer Essaypreis Charles Veillon),
1988 den Conrad-Ferdinand-Meyer-Preis,
1997 den Prix Lipp littéraire sowie 1998 den Johann-Heinrich-Merck-Preis.
„Das ehrt mich natürlich, aber Preise und Auszeichnungen sind vergänglich. Das Wort und die Schriften aber bleiben.“ Foto/Copyright: Mara Truog
In Ihrem Buch finden sich auch unveröffentlichte Lobreden. Zum Beispiel eine Lobrede auf Daniel Cohn-Bendit.
Jetzt ist sie ja in dem Buch, war jahrelang in der Schublade verschwunden. Ich habe diese Rede gehalten, als er einen Preis des Schweizer Fernsehens bekommen hat. Die Daniel-Cohn-Bendit-Rede ist ein typisches Beispiel, was mit Lobreden passieren kann: erarbeiten, halten, verschwinden. Glücklicherweise wurde diese für das Buch wieder ausgegraben.
Wie sind Sie auf die Idee gekommen, das Loben wieder erinnerlich zu machen?
Diese Form der Rhetorik hat mich einfach interessiert. Ich habe viele Lobreden geschrieben, ohne je eigentlich über die Geschichte oder die Schwierigkeiten und über die Tradition der Lobrede genauer nachzudenken. Dann habe ich gedacht, so viele Menschen hast Du gelobt, überleg das mal, das könnte doch auch ein Buch sein, wenn ich dazu eine Art historische Einführung schreibe, durch die die Leser dieses Thema verorten können. Indem man sagt, dass war in der Antike so, dann ist es weitergegangen in die europäische Tradition und ist in Frankreich so und in England eher anders gewesen. Die Geschichte der Lobreden wäre ein interessantes, umfangreiches Buchprojekt. So weit wollte ich es nicht treiben. Ich wollte eigentlich an konkreten Beispielen aufzeigen, wie eine Lobrede aussehen kann. Nicht muss, sondern einfach kann. Darum habe ich die Reden auch in Kategorien eingeteilt. Ein Frauenlob ist etwas anderes, als die Verdienste eines Wissenschaftlers zu schildern.
Die Anlässe können sehr unterschiedlich sein. Ich habe aber gefunden, es ist interessant, dies einmal in einem Zusammenhang zu sehen.
Braucht eine Gesellschaft das Lob?
Eindeutig. Eine Gesellschaft, die nicht mehr wahrnimmt, was lebenswert und lobenswürdig ist, die wertet nicht mehr richtig. Wir brauchen das Lob, um die Wertigkeit im Leben zu finden. Um sagen zu können, das ist gut so oder das ist nicht gut so.
Darum braucht es neben dem Lob genauso die Kritik. Ich gehe noch weiter: Selbst beim Lob ist Kritiklosigkeit ein Mangel. Es passiert oft, dass wir uns im Lob verrennen. Man sagt, die Liebe ist eine exquisite Form der Anerkennung, und da stellt sich oft heraus, dass sich die Menschen in dieser Qualität täuschen. Weil die Brüchigkeit der Anerkennung des Anderen sichtbar wird, wenn die Konflikte entstehen, wenn Unzufriedenheit aufbricht, was man im ersten Enthusiasmus nicht merkt. Liebesgeschichten fangen mit kritikloser, übermäßiger Anerkennung an. Alles ist toll, bis die ersten Risse auftreten.
Dennoch ist es gut, dass es dieses Gefühl der restlosen Begeisterung gibt. Die Realität kriecht dann noch schnell genug in das Leben.
Können Diktatoren loben?
Ja, Selbstlob.
Franco ist ein tolles Beispiel: Was der für einen Staat aufgebaut hat von Leuten, die eigentlich nichts anderes taten als Lob und Preis des Herrschenden permanent zu verkünden. Das gab es bis Donald Trump nur in Diktaturen. Lob oder Selbstlob aus falschen Gründen. Die Ereignisse in Venezuela machen das noch deutlicher. Eine völlig desolate Wirtschaft. Inflation von zwei Millionen Prozent. Aber Präsident Nicolas Maduro ließ sich im Staatsfernsehen feiern, stellte Misserfolge als Erfolge dar. Damit nicht genug: Er wollte sogar die „Errungenschaften der bolivarischen Revolution“ in der Verfassung verankern lassen. Unglaublich.
Schon Aristoteles und Platon warnten: „Man muss die Rhetorik immer an die Ethik zurückbinden.“ Wenn das nicht der Fall ist, sind wir falsch unterwegs.
Lob und Moral, wie passt das zusammen?
Eine untrennbare Verbindung. Diktatoren haben keine Moral, also ist ihr Loben falsch.
Ich bin davon überzeugt, in demokratischen Gesellschaften ist es einfacher, moralische Instanzen begleitend wachsen zu lassen. In Diktaturen ist es sehr viel schwieriger, Moral als eine Kontrollinstanz zu etablieren. Wie man Hellhörigkeit für Ungerechtigkeit und Unzumutbarkeit gewinnen kann in der modernen Gesellschaft, das ist etwas, was heute Philosophen und Ethiker enorm beschäftigt.
Heute hat jede demokratische Regierung eine Ethikkommission. In ihr sitzen all jene, die ihre Ohren aufgestellt haben, damit sie wirklich alles mitbekommen, was im Gesetzgebungsprozess passieren könnte. Warum muss das so sein? Ganz einfach nur, damit auch Minderheiten, die am Rande der Gesellschaft stehen, nicht übersehen werden. Ich glaube, das ist das Optimale, was man machen kann. Man muss sozusagen die Gewissensinstanz institutionalisieren. Lob und Moral sind also unzertrennlich.
Entwickelt sich die Welt zu schnell? Kommt der Mensch nicht mehr mit?
Entwicklung lässt sich nicht so steuern, dass man etwas künstlich verlangsamen kann. Es ist aber natürlich ein großes ethisches Problem, was der Mensch probieren kann und darf. Sei es in der medizinischen Forschung oder in der digitalen Welt. Allerdings bezweifle ich, dass festgelegte Regeln oder Grenzen niemanden abhalten werden, immer weiter und weiter zu forschen. Entscheidend ist diese genuine Neugier für eine Antwort auf Fragen wie: Was macht das Leben zum Leben? Wie bekommen wir das Leben noch besser unter Kontrolle? Solange es eine Möglichkeit gibt, den Antworten näherzukommen, wird es auf der Welt diese Neugier geben, die bereit ist, auch moralische Grenzen zu überschreiten.
Also wird Ethik immer dem Profit und der Rendite untergeordnet?
Grundsätzlich ja, aber es gibt die offene Gesellschaft, die das an vielen Punkten immer wieder verhindert. Nur in ihr funktionierten letztendlich moralische Instanzen, wenn auch nicht immer perfekt. Nehmen Sie die Kirchen. Sie haben in vielen Jahrhunderten wunderbare Dinge geleistet, aber auch so viel Schreckliches angerichtet und geduldet. Die Kirchen konnten über Jahrhunderte feste, moralische Mauern errichten, die inzwischen aber bröckeln. Die dem Leben dienende Wahrheit muss immer weiter gesucht werden. Im Dialog mit allen, die um Gerechtigkeit und um die Zumutbarkeit des Daseins bemüht sind.
Wo würden Sie außer der Schweiz gern leben?
Überall dort, wo ich die Sprache mitsprechen und erfühlen kann.
Deutschland, Frankreich, Italien. Ich habe eine besondere Liebe zu Italien, aber ich könnte zum Beispiel auch in Lyon leben. So eine phantastische Stadt. Oder Salamanca, auch für eine Woche. Wunderbar.
Was haben Sie aus München mitgenommen?
Viel, nicht nur die Liebe zum Fön. Konzentrierte Fülle in den Geisteswissenschaften. Als ich 1965 dort studiert habe, gab es lediglich zehn Professuren für Philosophie. Das ist mit heute nicht zu vergleichen. München ist eine Stadt, in der der Geist anfängt zu tanzen. Diese Mischung einer großen Kulturstadt, aber auch die Nähe zum Landleben ist eine unglaubliche Verbindung.
Heute könnte ich dort und in Berlin und in Hamburg ganz sicher leben. Aber ich könnte älter werden und nicht mehr so viel reisen, dann auch in kleinen Städten wie Regensburg oder Augsburg.
Beeindruckt bin ich auch von Frankfurt an der Oder, die Stadt an einer offenen Grenze. Es ist wunderbar zwischen Polen und Deutschland hin- und herzupendeln.
Dresden und Leipzig gefallen mir. Es wäre für mich kein Schicksalsschlag, wenn ich irgendwo in Deutschland leben müsste.
Wie haben die Deutschen Wende und Wiedervereinigung bewältigt?
Grandios. Ich habe großen Respekt vor diesem politischen Modell der Solidarität. Es ist nicht alles so gelungen, wie es gewünscht war, und es wird auch noch Zeit brauchen. Es gibt Unterschiede, aber warum muss der Osten denn genauso ausschauen wie Westdeutschland? Darum denke ich, Unterschiede bereichern das doch.
Ich war kürzlich in Jena. Wie dieses Jena sich gemacht hat, ist einfach eindrucksvoll. Natürlich sind Landflucht, Nachwuchsmangel, etc. ein Problem, aber das ist auch bei uns in den Seitentälern, Graubünden so. Wie kann man Dorfleben noch attraktiv machen, wenn bestimmte Dinge nicht mehr da sind. Keine Schulen, Kindergärten, das sind Probleme.
Ihr höchstes Lob?
Wirklich gut!
Was sollte nicht auf Ihrem Grabstein stehen?
Er hat Sprache missverstanden.
Iso Camartin auf der wunderbaren Dachterrasse seiner Wohnung, die einen einmaligen Ausblick auf See und Zürich bietet. Nachdenklich, lächelnd, erklärend. Iso Camartin hörte allen Fragen ganz genau zu und überlegte sich seine Antwort ganz genau und dezidiert.
Herausgekommen ist ein Gespräch über „Die Kunst des Lobens“, die Veränderung von Sprache, die Macht der Sprache und die Gefahren, die Sprache in sich trägt. Gerade in Zeiten aufkommender Rechtspopulisten. Während über Iso Camartin die Leichtigkeit des Wortes zu schweben schien, musste ich mich stark konzentrieren und ganz genau zuhören, um alles zu verstehen. Für mich war es beeindruckend und ich ernannte Iso Camartin zum „König der Wörter“. Darüber lächelte er amüsiert, aber nicht abwertend. Fotos/Copyright: Mara Truog
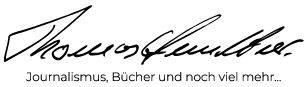










Hinterlasse einen Kommentar