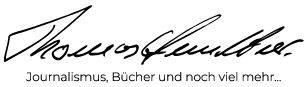Rita Süssmuth
„So können wir nicht mehr weiterleben!“

Rita Süssmuth in ihrem Büro unweit des Bundestags. Am 25. November 1988 wurde sie mit 380 von 473 gültigen Stimmen an die Spitze des Parlaments gewählt. Auch in diesem Amt machte sie von sich reden: Sie leitete die nach Vollendung der deutschen Einheit notwendig gewordene Reform des Parlaments ein und bereitete dessen Umzug nach Berlin vor. Das Amt hatte Rita Süssmuth fast zehn Jahre inne.
Zudem bezog Süssmuth auch als Bundestagspräsidentin weiterhin offen Stellung – zum Beispiel zu frauenpolitischen Fragen. „Der Bundestagspräsident muss kein Neutrum sein“, begründete sie ihre Einstellung später einmal in einem Interview mit der „Süddeutschen Zeitung“ .
Foto/Copyright: Markus Nowak
Prof. Dr. Rita Süssmuth (geborene Kickuth) wurde am 17. Februar 1937 in Wuppertal als Tochter eines Lehrers geboren. Sie wuchs in Wadersloh auf und legte 1956 am Emsland-Gymnasium in Rheine ihr Abitur ab und studierte in Münster, Tübingen und Paris Romanistik und Geschichte. Nach dem Staatsexamen für das Lehramt 1961 absolvierte sie ein Postgraduiertenstudium in Erziehungswissenschaften, Psychologie und Soziologie. Sie promovierte 1964. Im gleichen Jahr heiratete sie Hochschulprofessor Hans Süssmuth, mit dem sie eine Tochter hat. Nach vielen Jahren als wissenschaftliche Assistentin und Dozentin wurde Rita Süssmuth 1971 zur ordentlichen Professorin für Erziehungswissenschaft an der Pädagogischen Hochschule Ruhr ernannt.
Zehn Jahre später wurde sie Mitglied der CDU, zwei Jahre danach übernahm sie als Vorsitzende den Fachausschuss der Partei für Familienpolitik.
Von 1987 bis 2002 saß Rita Süssmuth im Bundestag, gehörte vom 26. September 1985 bis zum 25. November 1988 dem Kabinett von Helmut Kohl als Bundesministerin für Jugend, Familie und Gesundheit an. Von diesem Tag bis zum 26. Dezember 1998 war Rita Süssmuth Präsidentin des Deutschen Bundestages.
Bis heute ist Rita Süssmuth in zahlreichen Ämtern und Organisationen tätig, pendelt zwischen ihrem Wohnort Neuss und Berlin.
Irgendwie hat Rita Süssmuth auch mein Leben begleitet. Kritisch, keine Angst vor großen Tieren und immer klare Kante zeigen – so würde ich sie beschreiben. Ich muss nicht immer die Meinung des anderen teilen, um Respekt zollen zu können, so denke ich. Ich war neugierig auf diese Frau und bemühte mich um einen Interviewtermin. „Denn“, so dachte ich „eine Frau wie Rita Süssmuth, eine Politikerin, die so viel erlebt und mitgestaltet hat, wird erzählen können.“ Und genauso ist es gekommen. Meine Anfrage hatte Erfolg und so trafen der Fotograf Markus Nowak und ich am 6. Juni 2019 nachmittags als letzte Gäste in ihrem Berliner Büro ein. Das Gespräch ging weit über die vereinbarte Zeit hinaus und hätte bestimmt noch länger gedauert, wenn Frau Süssmuth nicht gern nach Hause zu ihrem Mann in Neuss ins Wochenende gefahren wäre.
Die Stadtgottes veröffentlichte das Interview in der Weihnachtsausgabe 2019. Deshalb drehen sich natürlich einige Fragen um das Fest. Aber wie bei vielen meiner Gespräche mit Personen aus dem öffentlichen Leben, die anderen Themen, die Frau Süssmuth mit mir besprochen hat, sind genauso aktuell wie vor zwei Jahren und beweisen: Wandel und gesellschaftliche Veränderungen können oft lange dauern.

Rita Süssmuth hört nicht nur zu und antwortet auf die Fragen von mir. Nein, sie will die Konfrontation und Auseindandersetzung mit den Themen, die ihr am Herzen liegen. Sie „provoziert“ mit Gegenfragen, analysiert jede Meinung des Gesprächspartners, tischt neue Argumente auf, ist aber auch bereit, einem anderen Gedankengang nicht nur zu folgen, sondern ihn auch zu akzeptieren. Das gab dem Interview seinen besonderen Reiz und führte weg vom „Frage-und-Antwort-Spiel“ in eine spannende Diskussion.
Foto/Copyright: Markus Nowak
Frau Süssmuth, bringt es heute noch Spaß in der Politik zu sein?
Sicherlich. Nur sage ich auch, ein politischer Mensch zu sein, bedeutet nicht nur Vergnügen, sondern auch Verpflichtung. Für mich ist es eine Selbstverpflichtung. Ich denke, so sollte es auch für alle Bürgerinnen und Bürger sein, die in einer Demokratie leben. Politik kritisch, aber auch respektvoll zu begleiten.
Ist dem nicht so?
Im Großen und Ganzen sicherlich. Wenn ich erlebe, wie sich unzählige Menschen zu öffentlichen Protesten gegen rechtspopulistische Gruppen versammeln, leite ich daraus ab, dass unsere Bevölkerung wieder nachdenklicher geworden ist. Dieses positive Engagement gibt mir Mut, dass unsere Demokratie noch lange existieren wird. Andererseits…
Andererseits?
Wir leben in einer Zeit massiver Umbrüche. Ich habe nicht damit gerechnet, dass wir wieder in eine Situation kommen, in der der Kalte Krieg nicht nur ganz nahe zu sein scheint, sondern wir uns fragen müssen: Gibt es einen neuen Krieg? Alle Politiker sagen, wir wollen das nicht. Dennoch wird überall mit dem militärischen Säbel gerasselt. Aufrüstung, die Entwicklung neuer Superwaffen, das alles schien erledigt. Doch die Realität sieht anders aus.
Was bedeutet das?
Wie ich eben sagte, unsere Bevölkerung ist wieder viel nachdenklicher geworden. Gleichzeitig wächst aber auch die Verunsicherung. PolitikerInnen müssen sich also fragen, wie helfen wir den Menschen aus der Verunsicherung wieder heraus und wie stärken wir sie? Das bedarf einer guten politischen Aufklärung und einer guten Politik. Das müssen wir angehen.
Wie?
Sehen Sie, ich habe mir nicht vorstellen können, dass wir nach so langer Zeit des Friedens plötzlich um unsere Partner ringen müssen. Fakt aber ist, dass die amerikanisch-europäischen Beziehungen, einer Schwächung ausgesetzt sind, wie ich es niemals für möglich gehalten hätte. Das Gleiche gilt für die verschobenen Achsen in der Welt: Russland, China, Europa – nichts ist mehr so, wie es einmal war. Das wirft viele Fragen auf. Zum Beispiel: Welche Machtkonstellationen ergeben sich in den nächsten Jahren? Welche Rolle wird Europa spielen?
Ich bin überzeugte Europäerin, sehe aber auch, dass vieles schief läuft und extremer Reformbedarf besteht. Jedes EU-Land hat seine eigene Identität und dieses Nationale sollte erhalten bleiben. Das sieht ja auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron so. Auch er ist überzeugter Europäer und kämpft zu Recht dafür, dass sich die nationale Souveränität mit der europäischen verbindet.
Das sehen Italien, Polen oder Ungarn, aber auch viele Abgeordnete nicht so. Im Gegenteil. Nationalismus wird zum höchsten Gut erklärt und selbst die Abschaffung der EU ist kein Tabu mehr. Wie konnte es, gerade nach dem Fall der Mauer und der Hoffnung auf ein europäisches Zusammenwachsen, dazu kommen?
Da fällt mir eine zufriedenstellende Antwort schwer, da auch ich noch auf der Suche nach einer solchen bin.
Ein Grund könnte sein, dass wir nach dem Fall der Mauer und dem Zusammenbrechen sozialistischer und kommunistischer Diktaturen so getan haben, als wären wir die Glücksbringer. Das mag in Teilen auch gestimmt haben. Aber und das ist für mich etwas ganz Entscheidendes, ohne den Widerstand in Mittel- und Osteuropa wäre nichts passiert. Polen war ein Vorreiter für die Grenzöffnung nach Österreich durch die ungarische Regierung. Nicht zu vergessen Gorbatschow und die Montagsdemonstrationen in der ehemaligen DDR. Das und noch viele gesellschaftliche, politische und menschliche Strömungen haben wir unterschätzt.
Wir haben die Menschen nur als die Gefangenen und Unterdrückten eines Systems gesehen. Aber während der kommunistischen Herrschaft ist etwas anderes entstanden: Die Menschen haben sich Nischen gesucht, in denen sie sozial und emotional ein Leben des Zusammenhalts geführt haben.
Das wollten wir wohl nicht sehen. Wir haben gedacht: „Wir geben und sie nehmen.“ Mit dramatischen Folgen: Rechtspopulistisches Gedankengut und ein neuer Nationalismus in Europa konnten sich ausbreiten und an Einfluss gewinnen.
Ein anderer Grund ist sicherlich die Globalisierung. Sie hat zu einem ungezähmten Kapitalismus geführt, der die meisten Menschen auf der Strecke lässt. Jetzt geht es darum, schnellstmöglich zu einer fairen, sozialen Marktwirtschaft zu finden.
Das sind für mich wichtige Faktoren. Der Allerwichtigste aber ist: Wir müssen die Menschen aus dem Osten und ihre Lebensleistung anerkennen und respektieren. Noch heute höre ich von vielen Frauen den Vorwurf: „Ihr kennt unsere Biografien ja gar nicht.“ Sie haben recht.
Inwiefern?
Nun, heute dürfen wir erkennen, dass insbesondere die Frauen im Osten ein völlig anderes Selbstwertgefühl entwickelt hatten. Arbeit und Bestätigung – beides war selbstverständlich. Das alles war plötzlich weg. Viele Frauen haben mir später gesagt, was nutzen uns die Stadterneuerung, die Verbesserung der Infrastruktur, die schönen Straßen und renovierten Häuser. Was nützt uns das, wenn wir keine Arbeit und Anerkennung haben.
Ich habe ein kleines Bändchen mit Biografien von Ost-Frauen durchgeblättert. Älterer, mittleren Alters und junger Frauen. Beim Lesen und Betrachten der Fotos stellte ich fest, oh, die haben ja alle ein ausgeprägtes Selbstwertgefühl. Von wegen, wir wurden nur unterdrückt, wir können nichts. Um ehrlich zu sein, waren diese Frauen sogar selbständiger und weiter als unsereins in der westlichen Gesellschaft. Und ich fragte mich, wann werden sie rebellisch und sagen zu uns: „Jetzt hört mal auf mit eurer Emanzipation, wir waren schon immer emanzipiert.“ Und so ist es ja auch gekommen.
Was ja auch ganz wichtig war.
Lothar de Maizière sagte am Vorabend der Wiedervereinigung, am 2. Oktober 1990: „Wir sehen es als eine wichtige Aufgabe an, das Zusammenwachsen ganz Europas zu fördern. Wir wollen für die Menschen im Osten und im Westen unseres Kontinents mit ihren unterschiedlichen Lebensumständen, Bedürfnissen und Erwartungen ein Bindeglied sein“. Das haben wir zwar gehört, aber es ist alles an der Oberfläche geblieben. Wir alle haben uns viel zu wenig darauf eingelassen.
Aber glauben Sie nicht auch, dass diese politischen Verschiebungen, in Deutschland und Europa, nicht auch sehr viel damit zu tun haben, dass die christlich demokratischen Parteien ihr C immer mehr in den Hintergrund gedrückt haben?
Sie stellen mir jetzt eine absolute Kernfrage. Es ärgert mich, dass das Christliche nicht nur in den Hintergrund gerückt ist. Dazu fällt mir sofort ein: Jesus hätte uns wahrscheinlich aus dem Tempel gejagt (Matth. 21,12 – die Redaktion), wenn er gesehen hätte, wie wir mit dem C umgehen. Das zeigt sich bei der Flüchtlingspolitik. Es zeigt sich beim Umgang mit den ärmeren Menschen. Um genauer zu sein: mit den bettelarmen Menschen.
Darüber bin ich tief beunruhigt. Gott sei Dank, gibt es in unseren Kirchen immer noch den notwendigen Beistand.
Nehmen wir die Flüchtlinge. Wir fragen doch nicht mehr, wie schaffen wir es, dass alle, die hier angekommen sind, ein produktives und ein hoffnungsvolles Leben führen können. Nein, wir scheinen nur noch zu fragen, wie wir sie wieder loswerden oder wie wir verhindern, dass sie zu uns kommen. Zum Glück gibt es auch in diesem Land noch Menschen, die für diese Werthaltung kämpfen und sich dafür einsetzen.
Und bei der Armut?
Wir müssen unsere Gesellschaft wieder auf ein moralisch, ethisch gefestigtes Wertefundament stellen und unserer sozialen Verantwortung gerecht werden. Wir können nicht immer nur von Wachstum und Rendite sprechen und unser Denken und Handeln darauf ausrichten. Ständiges Wirtschaftswachstum kann nicht der Hauptfaktor sein. Davor warnte Papst Johannes Paul II. bereits in der im Mai 1991 veröffentlichten Enzyklika „Centesimus Annus“, in der er unter anderem schrieb, dass die Gefahr besteht, „dass sich eine radikale kapitalistische Ideologie breitmacht“. An anderer Stelle warnte er davor, in einem „blinden Glauben“ alles der freien Entfaltung der Marktkräfte zu überlassen.
Genauso ist es aber gekommen. Und davon müssen wir wieder weg.
Müssen wir insgesamt umdenken?
Ich glaube, wir sind gerade dabei. Ich glaube, auch das Denken an sich verändert sich gerade. Überlegen Sie mal, wann haben wir eine Frage jemals so intensiv gestellt, wie die, die wir jetzt seit Wochen diskutieren. Die Frage, wie wir unseren Planeten für künftige Generationen retten.
Wir alle wussten schon lange, dass es nicht gut ist, was wir tun. Angefangen bei dem Müll im Meer, über die Plastikschwemme oder dem maßlosen CO2-Ausstoß. Das geht seit Jahrzehnten so. Doch erst jetzt verändern Millionen Menschen ihr Denken und stellen die entscheidende Frage: „Wollen und können wir so überhaupt noch leben?“
Ich sage: „Nein, können und wollen wir nicht!“ Die Zeit, die uns jetzt noch gegeben ist, ist eine sehr begrenzte. Unser Planet hat nicht beliebige Erneuerungsmöglichkeiten.
„Wischiwaschi können wir nicht mehr gebrauchen!“
„Wischiwaschi können wir nicht mehr gebrauchen!“

Für ihr politisches und gesellschaftliches Engagement wurde Rita Süssmuth vielfach geehrt und ausgezeichnet. Hier einige Beispiele:
Ehrendoktorwürden: unter anderem von den Universitäten Bochum, Tarnowo (Bulgarien), Johns-Hopkins-Universität Baltimore (USA), Ben-Gurion-Universität des Negev Be’er Scheva (Israel).
Auszeichnungen: 1989 Leibniz-Medaille der Akademie der Wissenschaften und der Literatur, Mainz; 1990 Großkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland; 2007 Niedersächsische Landesmedaille; 2011 Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen; 2016 Verdienstorden des Landes Brandenburg.
Foto/Copyright: Markus Nowak
Aber wer kann handeln? Wenn Sie sich unsere Strukturen ansehen. Wir unterschreiben Klimaabkommen, halten aber die Vorgaben nicht ein. Wir suchen nach Lösungen und finden keine Antworten.
Das ist zutreffend und trifft gleichzeitig nicht zu. Was erleben wir derzeit? Die einen lehnen alles ab. Die anderen wollen richtig loslegen. Zum Beispiel beim Klimaschutz. Nach dem Motto: „Da lassen wir euch nicht mehr in Ruhe.“ Das werden immer mehr. Ich spüre, die Menschen vegetieren nicht vor sich hin, sondern stehen auf und wehren sich. „Wer handelt?“, haben Sie gefragt. Ich sage, wir alle. Wir sind doch nicht ohnmächtig. Ohnmächtig sind wir nur, wenn wir sagen, da kann man nichts machen. Doch, jeder kann was machen. Wenn wir uns zusammenschließen, und nicht jeder für sich sagt: „Ist ja nicht mein Problem.“ Es ist unser Problem! Unser aller Problem!
Ich habe in meinem Leben immer gemerkt, zunächst ist die Gruppe, die sich aus der vermeintlichen Ohnmacht erhebt, immer nur sehr klein. Doch sie wird größer und größer, ist oft genug zur Welle geworden. Egal, ob die 68er-Bewegung, die Frauenbewegung oder jetzt der Klimaprotest.
Hier muss die Politik einhaken, mit eigenen Ideen und Konzepten.
In unserem Land gibt es genügend Ideen, seien es Initiativen für die Älteren, die Jüngeren oder die Ausgegrenzten. Oder für Umweltschutz oder neue Technologien. Diese Dinge müssen jetzt unverzüglich von den Entscheidern aufgegriffen werden. Wir brauchen wieder klar formulierte Sätze mit klaren Aussagen und Richtungsweisungen. Nicht mehr dieses Wischiwaschi, man könnte, man sollte, man kann doch nicht. Wir müssen können.
Haben Sie ein Beispiel parat?
Gern. Ich war auf einem Ärztekongress. Da gab es plötzlich klare Forderungen zur Rückkehr zur „sprechenden Medizin“, also einer intensiven Kommunikation zwischen Arzt und Patient. In den letzten Jahren ging es ja nur noch um die Kosten, Einsparpotentiale oder Ärztemangel. Wo blieb der normale Patient?
Jetzt plötzlich steht die Beziehung zwischen Arzt und Patient wieder im Fokus. Es werden wieder klare Anforderungen gestellt und das Menschliche wieder in den Mittelpunkt gerückt.
Was lernen wir daraus?
Die Bereitschaft zum Umdenken ist vorhanden. Bei Klein und Groß, Alt oder Jung. Ich habe viel von kleinen Gemeinden gelernt, die unter starker Abwanderung leiden. Sie haben sich dagegen gestemmt mit neuen Ideen. Kindergartenkonzepte, genossenschaftlicher Lebensmittelladen, gemeinsamer Betrieb der Dorfkneipe und vieles mehr. Daraus entstand neues Zusammenleben, neue Gemeinsamkeit.
Da denke ich mir: Guckt mal genauer hin. Wir können aus den kleinen Zentren wahrscheinlich mehr lernen als aus den anonymen Millionenstädten.
Mögen Sie noch ein Beispiel hören?
Gern.
Zurück zu den Kommunen und Gemeinden. Beispiel Osnabrücker Raum. Da wirkt Bischof Franz-Josef Hermann Bode. Der hilft zusammen mit Caritas, Diakonie und der Bevölkerung ganz pragmatisch und im Sinne Christi, den Flüchtlingen eine neue Heimat zu geben:
Weg von großen Hallen. Zurück in überschaubare Unterkünfte. Aktive Unterstützung bei so banalen Alltagsdingen wie: Müllentsorgung, Kochmöglichkeiten, etc. In den Mittelpunkt stellt er hierbei nicht die ethnische Abstammung des Anderen, sondern die Frage: „Was für ein Mensch bist Du?“ Genau da müssen wir weitermachen, indem wir darüber nachdenken, wie wir das packen.
Übrigens: Schon in der Antike – zum Beispiel Aristoteles – wusste man, dass der Mensch ein denkendes Wesen ist. Aber: Auch Handeln setzt Denken und Nachdenken voraus. Auch Nachdenklichkeit. Aber nicht ohne zu handeln. Vita activa plus vita contemplativa. Ich kann mich nicht in meinen Lehnstuhl setzen, wenn es dringend an der Zeit ist, sich auf den Weg zu machen.
Haben wir das Denken verlernt?
Nein. Wir haben es nicht verlernt. Aber wir tun so, als sei das Denken derjenigen, die nicht genauso denken wie ich, gefährlich. Anstatt zu fragen – das finden wir auch bei Sokrates – kann der Andere nicht auch Recht haben? Hier befinden wir uns inmitten eines demokratischen Prozesses. Die Frage „kann der Andere nicht auch Recht haben“, wirkt für viele fast schon provokant, da wir als Individuen oftmals lieber alleiniger Urheber einer Lösungsfindung sind, als uns konstruktiv in einem lösungsorientierten Diskurs einzubringen.
Aber setzt dieses andere Denken nicht auch eine vernünftige Sprachkultur voraus, die wir im Parlament derzeit verlieren?
Das ist wieder so eine zentrale Frage. Wir haben eben darüber gesprochen, können wir uns entwickeln, ohne ein wertbezogenes Fundament zu haben? Woraus handeln wir denn? Woraus glauben wir denn, was ist für uns wichtig? Als Mensch? Unsere Sprache ist zum Teil verstümmelt und verroht. Wir antworten oftmals nur noch mit Worten wie „Ok“ oder „Ja, ja“.
Wir haben tatsächlich Schwierigkeiten mit Menschen zu sprechen. Dem Anderen zuzuhören. Was hat er denn nun gesagt, gemeint? Damit beginnt ja das Nachdenken. Was antworte ich? Da sind wir fast beim Dialog. Deswegen bedeutet Sprachbildung nicht, akademische Ausdrucksweise. Gemeint ist, welche Sprachkultur – und die Betonung liegt auf Kultur – entwickeln wir, damit das, was als wichtig erkannt und gesagt werden muss, auch mitgeteilt wird. Ich bin vorsichtig, aber ich wage es trotzdem: Wir brauchen auch wieder Botschaften, die den Menschen Orientierung geben.
Ohne Orientierung kann weder ein Kind noch ein Erwachsener sein. Ich behaupte nicht, dass wir heute den Anspruch auf Wahrheit und Endgültigkeit erheben können, das kann vielleicht ein tiefgläubiger Mensch. Uns, und das sage ich in aller Demut, sind Grenzen gesetzt. Trotzdem muss ich im Rahmen der Grenzen zum Thema die zentrale Frage stellen: Was können wir verändern?
Ich bin in die Politik gegangen, weil ich mich eigentlich an der Uni sehr eingeschränkt fühlte. Ich dachte: „Mensch, jetzt haben wir so viele Studien gemacht und es verändert sich nichts.“ Auch das kann niemand allein.
Mir wurde gesagt: „Ja, Sie mögen ja tolle Studien gemacht haben, aber Sie haben keine Mehrheit. Schaffen Sie sich erst mal eine Mehrheit. Dann geht es vielleicht leichter.“
An diesen Mehrheiten arbeitet man lange, auch mit Rückfällen. Aber mich hat das Scheitern gelehrt – so schnell bekommt ihr mich nicht klein. Jetzt wollen wir doch mal sehen. Das setzt wieder neue Energien frei. Ich habe damals ein Buch geschrieben, das hieß: Frauen, der Resignation keine Chance. Ich habe das Glück gehabt, in meinem Denken und Handeln, immer das Licht am Ende des Tunnels zu sehen…
Hätte es unter Ihrer Leitung im Bundestag dazu kommen können, dass ein AfD-Kandidat für den Vizepräsidenten drei- oder viermal durchfliegt und so konsequent abgelehnt wird, egal, wer es ist?
Der Versuch eine Mehrheit für einen Kandidaten der AfD zu finden, ist nicht zu kritisieren. Aber in dem konkreten Fall ging und geht es darum, bestimmte Dinge nicht ad absurdum zu führen.
Und diese Methode, den x-ten Vorschlag zu machen für ein Mitglied im Präsidium, macht doch keinen Sinn, wenn er doch nicht gewählt wird.
Für mich standen immer die Kommunikation und der Ausgleich im Vordergrund. Über alle Parteigrenzen hinweg.
Dazu gehört – neben einer sinnmachenden Auslegung der Geschäftsordnung – auch eine gehörige Portion Humor. Und – last but not least – die Bereitschaft auf die Menschlichkeit eines jeden Abgeordneten, selbst wenn es der politische Gegner ist, zu setzen. Das hat eigentlich immer funktioniert.
Einmal musste ich PDS-Abgeordnete dazu drängen, ihre Kleidung der Würde des Parlaments anzupassen. Ich habe Gregor Gysi gebeten seine Abgeordneten zu bitten, statt T-Shirts ein Jackett anzuziehen, ohne großes Theater oder öffentliches Lamentieren. Hat geklappt und Gregor Gysi hatte was bei mir gut.
Ich kann vieles nicht, aber den Umgang mit Menschen – ist anspruchsvoll, aber es lohnt sich.
Das ist doch das Entscheidende. Übergreifend denken. Gemeinsam argumentieren. Mit dem Ziel, eine Lösung zu finden.
Trotzdem müssen Sie den anderen Partner auch erst mal dahin bringen, dass er das auch will. Das fällt nicht vom Himmel. Mitunter klappt es nicht. Aber ich muss sagen, ich habe oftmals Glück gehabt, mehr über das Menschliche zu gehen als über das rein Rationale.
Als ich jung war, hat mein Vater, ihm war der Bildungsweg seiner Kinder extrem wichtig, mich immer gedrängt: sei diszipliniert, sei vernünftig, lerne zu argumentieren. Alles wichtig. Aber alles rational. Erst durch die Hirnforschung habe ich gelernt, die emotionale und soziale Seite sind genauso wichtig wie die kognitive. Deswegen lasse ich die nicht aus.
Nur aus der Hirnforschung oder auch aus Ihrem Glauben?
Für mich spielt der Glaube eine zentrale Rolle. Wir sind doch heute sehr gedrillt worden, oder trainiert worden, für unseren Kopf. Auch bei allen Bildungstests wird nur auf das Wissen, das Rationale geachtet.
Da waren unsere alten Pädagogen, zum Beispiel Pestalozzi, sehr viel weiter. Sie dachten ganzheitlich, sahen den gesamten Menschen mit all seinen Kräften. Heute ist es doch so: Wenn ich bei diesem Thema das Wort „Glauben“ verwenden würde, wäre das ja gestrig und veraltet. Aber, ich lass mir das nicht nehmen. Und ich lege Wert darauf, dass selbst die Hirnforschung, das zum Tragen bringt, was wir in der menschlichen Zivilisation vernachlässigt haben.

Es ist nie schlecht, sich an Dinge aus der Vergangenheit zu erinnern. Hier einige Fakten aus dem politischen Leben von Rita Süssmuth: Am 26. September 1985 wurde sie als Bundesministerin für Jugend, Familie und Gesundheit berufen. 1986 gab es eine wichtige Änderung und das Amt hieß nun: Bundesministerium für Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit. Nach ihrer Wahl zur Bundestagspräsidentin schied sie am 25. November 1988 aus dem Kabinett aus. Sie forderte einen möglichst weit gefassten Gesundheitsbegriff und wandte sich gegen die Aufhebung des kassenärztlichen Schutzes bei Abtreibung. Konfrontiert mit AIDS setzte sie als Vorbeugungsmaßnahmen insbesondere auf ärztliche Aufklärung und Beratung. Daneben propagierte sie gegen Widerstände in ihrer Partei die Verwendung von Kondomen zur Prävention. Heftige Kritik an Rita Süssmuth kam auf, als bekannt wurde, dass ungeprüfte Medikamente für Bluter nicht zurückgerufen wurden. Zahlreiche Bluter in Deutschland waren durch ungeprüfte Medikamente mit HIV infiziert worden und starben. Genaue Zahlen sind nicht bekannt, aber es können bis zu 2000 mit HIV infizierte Bluter gewesen sein. 1987 initiierte sie die Gründung der Nationalen AIDS-Stiftung und unterstützte die spätere Fusion mit der Deutschen AIDS-Stiftung „Positiv leben“ im Jahr 1996. War sie zunächst als Vorsitzende des Stiftungskuratoriums tätig, ist sie heute deren Ehrenvorsitzende.
Foto/Copyright: Markus Nowak
Aber ist es nicht genau auch wieder das? Dieses ewige Sagen: Was soll denn der Glaube? Das ist doch von gestern. Der Glaube ist doch ein Wert, der für uns fundamental ist. Wenn es keinen Glauben gibt, gibt es doch auch keine Hoffnung.
Ja, genau. Es ist eben nicht gestrig. Tatsache ist doch: Wir alle machen unsere Erfahrungen – egal, ob Jung oder Alt. Wichtig ist dabei doch nur: Auch bei Misserfolgen, den Glauben nicht zu verlieren. „Vertrau auf Dich. Glaube an Dich.“ Heute gescheitert, morgen weitermachen – das sollte die Prämisse sein.
Sie haben in Ihrem politischen und außerpolitischen Leben entscheidend nicht nur mit dazu beigetragen, dass Frauen mehr Rechte bekommen, sondern sich auch ein neues Selbstverständnis in der Rolle als Frau entwickelt hat. Brauchen wir heute unter diesem Aspekt überhaupt noch eine Frauenquote?
Wir brauchten eine Frauenquote. Heute fordere ich selbstverständliche Parität. Das ist noch gerechter. Dann sind wir endlich aus dieser Diskussion heraus: Die einen wollen keine Quotenfrauen sein. Die anderen finden, dass das eine Begünstigung der Frauen ist und nicht ihre Leistungen anerkennt. Bei der Parität wird niemandem etwas weggenommen. Noch ist es anders: 70 Prozent männlicher Einfluss, nur 30 Prozent weiblicher. Da sind wir noch nicht weit gekommen. Im Gegenteil, wir hatten erhebliche Rückfälle in geringere Präsenz von Frauen im öffentlichen Leben. Egal, ob Wirtschaft, Wissenschaft oder Politik. Da will ich Steigerungsraten, aber nicht um der Quantität willen allein. Die Quantität spielt eine Rolle, wenn der Anteil zu gering ist. Wir waren nur zwei Frauen im Sozial- oder Wirtschaftsausschuss, da kriegen sie nichts hin.
Ehrlich gesagt, es geht nicht um egomane Feministinnen.. Es geht darum, dass Frauen und Männer gemeinsam es schaffen, unsere Welt anders und besser zu gestalten. Ich habe das erlebt, als es um den Schutz des ungeborenen Lebens ging. Da meinten die Männer, nur mit Strafe können wir zu einer besseren Lösung kommen. Das war falsch und wurde von Frauen richtig erkannt. Und wir haben bessere Lösungen gefunden. Wir brauchen in allen gesellschaftlichen Fragen mehr als die üblichen Instrumente, die wir immer schon gehabt haben. Und da erlebe ich einen Wandel in der weiblichen Gesellschaft. Immer mehr Frauen fragen sich, wie kann ich mehr aus meinem Leben machen, wirkungsvoller werden? Wie kann ich dazu beitragen, die Gesellschaft positiv zu verändern? Gestalten! Das hält mich wach und gibt mir Kraft.
Aber wie kommen wir dahin? Was meinen Sie?
Wir kommen nur dazu, indem wir es jetzt machen und es nicht wieder dreißig oder vierzig Jahre verschieben.
Zweitens, indem wir es in einer Weise machen, ohne andauernd von Grundgesetzänderungen zu reden.
Wir haben bereits Fraktionen im Bundestag mit fünfzig oder mehr Prozent Frauenanteil – ohne Gesetzesänderung. Das sollten wir nun parteiübergreifend angehen.
Wenn wir dahin kommen, brauchen wir gar nicht so viel zu tun. Voraussetzung aber ist: Die Männer sollten aufhören, sich zu fragen, was aus ihnen wird, wenn sie einen Teil ihrer Macht mit den Frauen teilen müssen. Ich kann nur antworten: Wenn ihr nicht wollt, dann tut auch ein bisschen Zwang gut. Ich habe noch nie erlebt, dass fundamentale Änderungen komplett freiwillig gemacht wurden.
Ist das nicht ein schönes Gefühl, parteiübergreifend denken zu können?
Ja, sicher.
Wann hat sich das bei Ihnen entwickelt? Als Sie aus der Politik raus waren?
Nein, während meiner aktiven, politischen Zeit. Ich muss sagen, ich wollte nicht Parlamentspräsidentin werden.
Sehen Sie, ich bin in die praktische Politik wegen der Frauen eingestiegen. Dann kam AIDS und wurde für mich zur Feuertaufe. Werde ich es da schaffen, Menschen zu gewinnen, die nicht nur ausgrenzen wollen? Finde ich Unterstützer, die die Erkrankten nicht auf eine Insel oder in quarantäneähnliche Gefängnisse stecken wollen? Wir haben es geschafft, über einen anderen Weg, den der Prävention.
Und um den Kreis zu Ihrer ersten Frage zu schließen: Ja, Politik bringt Spaß. Im Parlament kann jeder Abgeordnete eine Menge bewegen und erreichen. Eine Menge machen. Fraktionsbindend und –übergreifend!
Aber ganz ehrlich, eigentlich ist das viel zu banal ausgedrückt. Mir hat Politik innere Lebensenergie gegeben und ich kann sagen, wir haben ein Stück Frieden geschaffen.
Auch wenn ich heute einsehe, dass wir es oft schaffen, jeden Konflikt zurückzuholen. Also, geht vieles oft bei null wieder los.
Letzte Frage, in wenigen Wochen feiern wir Weihnachten und Silvester. Was wünschen Sie unseren Leserinnen und Lesern?
Ich wünsche uns allen, dass wir nicht erdrückt werden von vermeintlich moralischen Grundsätzen. Wir sollten uns gerade in dieser Zeit befreit darauf einlassen, Dinge auch mal anders zu betrachten. Und zwar so, dass wir persönlich Freude daran haben.
Den Gedanken an Frieden, das ist ja eigentlich das Weihnachtsfest, diese Botschaft neu entdecken. Sei es in der eigenen Familie, mit sich selbst, mit den Menschen. Unter der Überschrift Freude. Das wollte auch unsere christliche Botschaft.
Mein zweiter Wunsch an alle ist, dass wir Menschen wieder die Erfahrung machen, dass wir nicht ohnmächtig sind. Dass wir verändern und gestalten können.
Wäre ich Theologin, würde ich sagen: „Lasst uns einander zum Heil werden und wünscht dem Anderen so viel Glück und Positives, dass er den Weg zurück ins wahre Leben findet.“
Wie feiern Sie Weihnachten?
In der Familie, mit allen Enkeln. Dazu gehört die Weihnachtsmette. Kleine Geschenke gehören auch dazu, nicht nur in unserer Familie, sondern auch nach Kambodscha.
Da auch bei diesem Interview die Bilder in unserer Galerie für sich sprechen, macht es mehr Sinn, Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, Rita Süssmuth noch ein wenig näherzubringen. In einem Interview mit dem katholischen Domradio antwortete sie am 17. Februar 2017 auf die Frage, was ihr größter politischer Erfolg gewesen sei: „Ich freue mich am meisten darüber, dass ich als Gesundheitsministerin Mitte der 80er-Jahre die Grundlage für die AIDS-Prävention legen konnte. Damals wusste man nur sehr wenig über die Krankheit, die Panik aber wurde immer größer. Mir war aber von Anfang an klar, dass der Grundsatz sein müsse, die Krankheit und nicht die Kranken zu bekämpfen. Wir wollten, dass die Betroffenen nicht ausgegrenzt werden und dass zugleich die Fallzahlen zurückgehen. Das ist meinem Team und mir ganz gut gelungen. Zur Seite standen mir damals auch Geistliche. Ich war damals in einem Gottesdienst in Hamburg und habe miterlebt, in welcher Not die HIV-Infizierten waren. In diesem Moment war es für sie – so glaube ich – ganz wichtig, dass sie sich zugehörig fühlen durften.“
Fotos/Copyright: Markus Nowak