Christoph Heubner
Nach Auschwitz: Nur Toleranz verhindert neuen Holocaust
Christoph Heubner will die Erinnerungen an den Holocaust lebendig halten - die Jugendbegegnungsstätte in Auschwitz hat er mit aufgebaut. Das Gespräch mit dem Vizepräsidenten des Internationalen Auschwitz Komitees wurde im Magazin der Steyler Missionare "Stadtgottes" im März 2020 abgedruckt, hat aber in der Zeit nichts von seiner Aktualität eingebüßt.
Christoph Heubner
Christoph Heubner wurde am 6. Mai 1949 als Sohn des Pfarrers Horst Heubner und seiner Frau Helga in Niederaula (Hessen) geboren. Nach dem Abitur in Marburg verweigerte er als Mitglied der Aktion Sühnezeichen den Kriegsdienst und arbeitete in Oxford in einem Obdachlosenasyl. Danach betreute er die ersten Besuchergruppen der Aktion Sühnezeichen in der KZ-Gedenkstätte Stutthof bei Danzig. Im Anschluss an den Zivildienst studierte Heubner Germanistik, Geschichte und Politik in Marburg sowie Kassel. Nach dem Examen arbeitete Christoph Heubner hauptamtlich bei der Aktion Sühnezeichen. Seit 1980 war er verantwortlich für die Fortführung der Planungen der Internationalen Jugendbegegnungsstätte in Oświęcim /Auschwitz. Seit 1985 arbeitete er auch für das Internationale Auschwitz Komitee (IAK). Heute ist er Geschäftsführender Vizepräsident des IAK in Berlin und Mitglied des Vorstandes der Stiftung für die Internationale Jugendbegegnungsstätte in Oświęcim/Auschwitz. Darüber hinaus hat sich Christoph Heubner als Literat und Autor einen Namen gemacht.

Christoph Heubner unterhält sich mit Überlebenden und schreibt deren Geschichte und Geschichten auf. Ein eindringliches Bewahren der Historie für die Zukunft, wenn es keine Zeitzeugen mehr gibt.
Herr Heubner, Ihr Vater war Pfarrer. Sie kamen über die Aktion Sühnezeichen mit Auschwitz in Kontakt und wurden stark geprägt vom Holocaust-Überlebenden und Mitbegründer der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau, Tadeusz Szymański. Sie sind Vizepräsident des Internationalen Auschwitz Komitees und Mitglied im Vorstand der Stiftung für die Internationale Jugendbegegnungsstätte in Oświęcim/Auschwitz. Sie setzen sich nahezu täglich mit dem schlimmsten Kapitel der Geschichte – dem Holocaust – auseinander. Können Sie noch an Gott glauben?
Ich denke, ja. Ich bin zwar kein regelmäßiger Kirchgänger, aber es wäre für mich unvorstellbar, die Kirche zu verlassen, die mich doch sehr geprägt hat. Und ich entdecke immer wieder mehr positive Dinge in ihr als negative. Insofern bin ich schon sehr geprägt. Das spüre ich auch an diesem Ort sehr deutlich, denn ich erlebe, wie Menschen hier in Auschwitz Orientierung suchen. Und einen Rahmen, in dem sie sich fallen lassen können. Sie kennen den berühmten Satz: „Man kann nicht tiefer fallen als in Gottes Hand.“ Das ist schon ein Satz, der hier von den Besuchern spürbar erfahren wird. Am Schluss bleibt für sie das Gefühl der Dankbarkeit, dass einem selber so etwas in seinem Leben erspart geblieben ist.
Dieses Sehen, das Fühlen. Als ich an einem Krematorium vorbeiging, hatte ich das Gefühl, den Rauch zu riechen. Das Grauen von Auschwitz und Birkenau I wird so auf eine sehr subtile Art deutlich, erfahrbar. Obwohl es nicht vorstellbar ist. Stellt sich nicht auch Ihnen die Frage: „Wie konnte Gott so etwas zulassen?“
Das ist natürlich eine Herausforderung und ich will darüber auch nicht leichtfertig hinweggehen. Aber die viel entscheidendere Frage ist für mich eine andere. Eine ganz einfache. Eine Frage, die vor der Frage nach Gott kommt. Sie lautet: Wo war eigentlich der Mensch?
Alles hier in Auschwitz wurde nach einer entsetzlichen, eiskalten menschlichen Logik aufgebaut. Einer Logik, dieMassenvernichtung systematisch organisierte. Eine Logik, die bis heute so viele unbeantwortete Fragen enthält, dass die Frage, wie Gott das zulassen konnte, fast schon blasphemisch erscheint.
Sie haben einmal gesagt: Auschwitz ist lange vor Auschwitz passiert. Wo und wie setzen Sie den Anfang?
Wenn Sie einen markanten Punkt haben wollen, werfen Sie einen Blick auf das Straßburger Münster. Dort gibt es eine Darstellung der Kirche als Herrin und die Synagoge als die Magd. Judenfeindschaft hat wirklich unsäglich weit zurückliegende Quellen. Es ist komisch, dass das, was zu einem breiten Strom des Hasses in der Vernichtung in Auschwitz angeschwollen ist, sich aus unzähligen Flüssen speist, die alle scheinbar plätschernd und harmlos daherkommen und sich dann plötzlich zu einem gewaltigen Schlund öffnen und das Böse kreieren.
Das beginnt bei Feindschaften, die es im Alltag zwischen Juden und Christen gegeben hat. Dann der instrumentalisierte Hass, den Politiker geschürt haben. Oder die Menschen, die in der Nachbarschaft Zweifel und Hass verbreiteten. Oder die Pogrome, die europaweit initiiert wurden.
Den Ort genau zu markieren, ist vielleicht einfacher, wenn Sie ihn auf die Menschen beziehen, die in Auschwitz ermordet worden sind. Wenn sie fragen: Wo sind sie geboren? Wo sind sie aufgewachsen? Wo hat ihre Verfolgung begonnen? In Bielefeld. Oder in Hannover. Oder in Budapest. Oder sonst irgendwo.
Niemand sollte vergessen, vor den Morden gab es die Statistik, auf der die Nazis aufgebaut haben. Sie wussten, welche Zahlen und Fakten dem, was sie wollten, zugrunde lagen. Und danach haben sie ihre Planungen akribisch aufgebaut. Entsprechend weit zurück können Sie die beginnenden Dinge zurückverfolgen.
Ist es erklärbar, dass wirklich niemand „Nein“ gesagt hat? Weder Unternehmen noch Reichsbahn noch irgendeine Institution, sondern dass sie alle mitgelaufen sind, dieser falschen Ideologie gefolgt sind. Also die gesamte herrschende Klasse.
Das ist eigentlich die totale Niederlage der bürgerlichen Welt. Das Versagen der bürgerlichen Fassade, hinter der alle verborgen waren. Es ist erstaunlich, dass diese bürgerliche Welt mit ihrem Etikettenschwindel so locker und rotzfrech danach wieder aufgestanden ist und geglaubt hat, weitermachen zu können. Ja, es hat niemand „Nein“ gesagt.
Die im Widerstand waren entsetzlich allein und so wenige, dass sie sich fast alle gekannt haben. Das ist vielleicht etwas übertrieben, aber der Kern stimmt.
Aber, ich vermag Ihnen auch keine Erklärung dafür zu liefern, warum Menschen, die sich kollegial, freundschaftlich verbunden waren, als Nachbarn oder gemeinsam einen Sportverein aufgebaut haben oder nebeneinander in der Gemeindevertretung saßen, sich plötzlich haben verwandeln lassen – in mit den Zähnen fletschende Rudel. Das ist bis heute völlig desillusionierend und entsetzlich.
Was empfinden Sie, wenn wir in Europa, in Deutschland, ja sogar weltweit genau diese Anfänge von damals wieder erleben?
Genau das: Dass es Anfänge sind.
Tun wir zu wenig dagegen?
Es gibt viele Versuche, etwas dagegen zu tun. Es gibt Sensibilität. Es gibt Aufmerksamkeit. Dennoch gibt es trotzdem immer das Böse, das überall sein Haupt erhebt.
Wenn Sie selber nicht betroffen sind, ist das zwar ein Problem, aber es brennt Ihnen nicht auf den Nägeln. Dennoch reicht es nicht, in Sonn- und Feiertagsreden immer nur das Problem Rechtspopulismus zu betonen. Es muss das Bewusstsein sensibilisiert und geweckt werden. Antisemitismus beginnt mit den Juden, aber er endet nie mit ihnen. Das ist eine Erkenntnis.
Wie schaffen wir dieses Bewusstsein? Wie bekommen wir den Antisemitismus aus den Köpfen? Wenn sich derzeit jemand gegen rechts wendet, wird er belächelt und es heißt, naja, es wird schon nicht so schlimm werden. Und alle berufen sich darauf, es kann nie wieder passieren, weil unsere Demokratie so gefestigt ist. Das sagen auch unsere Politiker immer wieder. Genau das glaube ich aber nicht. Für mich heißt das, die Gesellschaft hat nichts dazugelernt.
Das würde ich so pauschal nicht sagen. Gelernt hat man schon. Aber das mit der „gefestigten Demokratie“ ist ein Mantra. Es erinnert mich an ein Kind im Wald, das leise vor sich hin singt, um die eigene Angst zu bekämpfen.
Es gibt eine ganz einfache Wahrheit, die der Auschwitz-Häftling Primo Levi im jüdischen Block an die Wand geschrieben hat: „Es ist geschehen, und folglich kann es wieder geschehen: Darin liegt der Kern dessen, was wir zu sagen haben."
Das ist die ganz einfache Wahrheit. Die wir weiterverbreiten müssen. Und mehr ist dazu nicht zu sagen.
Was ist mit der gefestigten Demokratie?
Wir haben eine gefestigte Demokratie. Ja. Dennoch müssen wir uns fragen: Waren wir vor zwei Jahren nicht viel sicherer? Waren wir vor vier Jahren nicht viel, viel sicherer? Haben wir vor acht Jahren geglaubt, dass es in Deutschland national befreite Zonen gibt, in die Menschen mit anderer Hautfarbe nicht hineingehen sollten? Haben wir vor acht Jahren geglaubt, dass es in Mecklenburg Dörfer gibt, die völlig übernommen sind von Rechten?
Ich achte die Meinungen der Politiker und man sollte auch immer wieder auf die „gefestigte Demokratie“ hinweisen. Ich achte auch die Meinung unseres Bundespräsidenten, der immer wieder mit Nachdruck erklärt, dass die Erfolge der Demokratie deutlich betont werden müssen. Das muss vermittelt und deutlich gemacht werden. Trotzdem sind wir alle sehr gut beraten, realistisch zu sein und zu reflektieren, was da draußen wieder vor sich geht.
Ist das aber nicht erschreckend?
Das ist genau so ein Moment, Herr Pfundtner, in dem der Glaube ins Spiel kommt. Sie haben am Anfang nach dem christlichen Glauben gefragt. Ich antworte, genau an diesem Punkt möchte ich gerne vertrauen. Ich möchte mir kein rechtes Szenario immer wieder weiter vorspielen oder den Film zurückspulen. Nein, ich möchte sagen können, dass es uns diesmal gelingen wird, genügend Menschen zu finden, die sich in übergroßer Mehrzahl solchen Entwicklungen entgegenstellen, weil ihnen klar ist, was auf dem Spiel steht.
Auschwitz weckt Empathie für eine andere, wunderbare Welt
Auschwitz weckt Empathie für eine andere, wunderbare Welt
Das Internationale Auschwitzkomitee
Überlebende des Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau gründeten 1952 das Internationale Auschwitz Komitee (IAK). Damals die wichtigste Aufgabe: Die Welt wissen zu lassen, was im Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau tatsächlich geschah.
Das starke Aufkommen von Diskriminierung, Rassismus und Antisemitismus und insbesondere die wachsende Verleugnung dessen, was in Auschwitz passierte, veranlasste das IAK 1992 zu entscheiden, allen Organisationen, die aktiv daran arbeiten, ' Auschwitz ' eine wichtige Position in der moralischen und politischen Debatte und in der Ausbildung jüngerer Generationen zu sichern, auch die Möglichkeit einer Mitgliedschaft im IAK zu bieten. Mittlerweile sind viele Organisationen aus 19 Ländern dem Internationalen Auschwitz Komitee angeschlossen.
Im gleichen Jahr wurden auch erstmals vier jüngere Mitglieder in das Präsidium gewählt, das bis dahin nur aus Auschwitz-Überlebenden bestand.
2003 wurde in Berlin ein Koordinationsbüro unter der Leitung von Christoph Heubner eröffnet.

Das berüchtigte Tor mit dem auf den Kopf gestellten B.

Die Stacheldrähte werden immer wieder neu gespannt, damit alle Besucherinnen und Besucher auch optisch erkennen: Das war keine grüne Oase, sondern ein Ort der Vernichtung.

Ein mutiges Zeichen des Widerstands - das B.
Was beobachten Sie bei jungen Leuten?
Junge Menschen, die hierherkommen, erfahren, dass hierher Menschen deportiert wurden, die so alt waren wie sie heute. Oder wie ihre Eltern, ihre Geschwister und Großeltern. Gerade im Hinblick auf ihr eigenes Engagement und ihre eigenen Herausforderungen verlassen sie diesen Ort sehr nachdenklich. Gleichzeitig werden sie auch sehr empathisch einer wunderschönen Welt gegenüber, die es zu erhalten gilt. Auschwitz verändert jeden, der einmal hier war.
Es gab das Rammstein-Video mit einer Sequenz, in der die Bandmitglieder in Kleidung zu sehen waren, die an KZ-Häftlinge erinnerten. Die Rapper Kollegah und Farid Bang sangen von Körpern, die „definierter als Auschwitz-Insassen“ seien, was einen Skandal auslöste und letztendlich zum Aus des Musikpreises Echo führte ...
... ja, unglaubliche Vorfälle. Zu Rammstein kann ich nur sagen: Je mehr ich darüber erfahren habe, was alles passierte – rechtlich, medientechnisch usw., bevor das Video ins Netz gestellt wurde, um so perfider ist mein Eindruck über den Vorgang. Und ich nehme mir das Recht, zu sagen: „Was für eine Schweinerei, sich so eine Rolle anzumaßen und im Internet zu platzieren.“ Mit dem schlichten Kalkül, damit noch mehr Geld machen zu wollen. Noch schlimmer ist aber die spätere Rechtfertigung, zu behaupten, man wolle provozieren und Leute in Bewegung bringen. „Wir sind geläutert und wir lassen keinen Zweifel mehr an unserer politischen Haltung zu.“ Das ist einfach, schnelles Denken, schnelles Geld. Das geht so nicht!
Wie war das mit den Rappern? Wurde Ihr Bemühen angenommen, die andere Seite zu zeigen?
Ja, das war schon eine interessante Erfahrung. Das Internationale Auschwitz Komitee hatte Kollegah und Farid Bang in die Gedenkstätte eingeladen. Sie sind mit sehr viel Angst hierhergekommen, weil sie erwartet haben, hier wird so eine Art Scherbengericht über ihnen abgehalten und sie werden am Nasenring durch die Auschwitz-Manege geführt. Als die Bösen. Wir haben ganz bewusst den Termin nicht öffentlich gemacht, trotz Presseanfragen aus der ganzen Welt. Ganz ehrlich, so groß war das Medieninteresse noch nicht einmal, als Papst Franziskus 2016 Auschwitz besuchte.
Ich sage es mal ganz einfach. Farid Bang und Kollegah sind sehr sympathische, junge Männer, die für sich beanspruchen, zu spielen. Sie sehen sich als Schauspieler, die eine Rolle in diesem Rap-Milieu ausfüllen. Sie haben ihre Texte wirklich provokativ benutzt.
Haben Sie sich provozieren lassen?
Nein. Warum auch? Ich habe keine moralischen Appelle an sie gerichtet, sondern ich habe ihnen das gezeigt, was ich ihnen zeigen wollte. Zusammen mit dem stellvertretenden Direktor der Gedenkstätte. Wie jedem anderen Besucher auch. Tatsächlich wussten die Rapper kaum etwas von Auschwitz.
Wie haben die Rapper bei dem Rundgang reagiert?
Die Reaktion bei beiden war eigentlich Wut: „Wie können Menschen anderen Menschen das antun?“ Sie waren aber auch entsetzt über ihre eigene Ahnungslosigkeit. Ich glaube schon, dass die Rapper sehr beeindruckt waren.
Danach sind sie wieder abgefahren und ich habe nie mehr etwas davon gehört. Bis Kollegah dann in einem Interview gesagt hat, nie wieder mit dem Holocaust irgendwelche Scherze zu treiben oder das in seinen Liedern zu nutzen.
Neue Vorbilder. Neue soziale Medien. Das ist eine große Herausforderung für die Gedenkstätte.
Ohne Frage. Wir haben hier immer streng darauf geachtet, dass sich hier nicht auch nur im Ansatz rechte Tendenzen breitmachen. Sinnbildlich gesprochen, es gab Hakenkreuzschmierereien und irgendwelche idiotischen Aktionen von Rechtsextremen. Zum Beispiel: Ein Schwede schickte uns regelmäßig schwere Pakete mit Haaren aus Friseursalons. „Wir könnten damit unsere Bestände aktualisieren“, schrieb er zynisch dazu.
Heute haben wir eine ganz andere Situation: Durch das Internet brauchen die Rechten den authentischen Ort nicht mehr. Also müssen wir umdenken und mit der Gedenkstätte mehr nach außen gehen. Das war eine Erkenntnis aller Beteiligten, die in der Gedenkstätte arbeiten und darüber nachdenken, dass wir über unsere 2,5 Millionen Besucher hinaus, auch andere Menschen erreichen müssen, heutzutage. Besonders junge Menschen.
Anfang Januar endete im New Yorker „Museum of Jewish Heritage“ die große Ausstellung: „Auschwitz – Not long ago. Not far away“. In Madrid haben die Ausstellung 550.000 Besucher gesehen. Es wird eine Wanderausstellung durch viele europäische Städte.
Aber es gibt auch die andere Seite, die sich aus dieser neuen Herausforderung ergibt.
Welche?
Wenn wir als Gedenkstätte diesen Drang nach außen entwickeln, dann entwickelt die rechtsextreme Szene genauso das Verlangen, sich dazu zu äußern. Vor der Eröffnung der Ausstellung in Madrid hat es im Netz einen gigantischen Strom von antisemitischen und erinnerungsfeindlichen Eintragungen gegeben, die deutlich machen, wes Geistes Kind die rechte Szene der Welt ist. Da ist auf der einen Seite die Hemmschwelle gesunken. Andererseits - betrachten wir den gesamten Holocaust unter dem Begriff Auschwitz, besitzt dieser Begriff immer noch ein solches Potential, dass ein wirklich rechter Auschwitz-Leugner ab einem bestimmten Punkt, damit nicht ins Wohnzimmer und an den Kaffeetisch der Gesellschaft kommt. Und das ist gut so. So soll das auch bleiben.
Sie gehen nach außen. Aber auch bei den Besuchern, die nach Auschwitz kommen, hat sich das Verhalten geändert. Ein anderer Umgang mit dem Ort.
Das ist richtig. Die Wahrnehmung ist eine andere. Früher wurde fotografiert, heute werden an jedem Ort an jeder Stelle Selfies mit dem Handy geschossen. Jeder muss sich vor dem Tor „Arbeit macht frei“, vor einer Baracke oder einer Gaskammer ablichten.
Sie erinnern sich vielleicht, wie sich diese junge amerikanische Selfie-Prinzessin Breanna Mitchell auf dem Appellplatz gefilmt hat und das Video ins Netz stellte. Das löste einen Shitstorm im Netz aus. Für uns war das gut, denn mittlerweile verhalten sich die meisten Besucher schon sensibler, verstehen mehr, wo sie sind. Und, dass es ganz offensichtlich doch noch Orte gibt, an dem nicht die eigene Person im Mittelpunkt steht, sondern eine andere, deren Geschichte nahegekommen werden soll.
Über dem Tor ins Lager Auschwitz prangt der zynische Spruch „Arbeit macht frei“. Mit einem umgekehrten B. Dahinter verbirgt sich eine ganz besondere Geschichte.
Oh ja. Die SS in Auschwitz hatte einen allumfassenden Anspruch. Sie hatte den Anspruch, eine Welt zu kreieren, ja sogar, die eigentliche Welt zu sein. So wie sie auch der Auffassung war, dass der Rassenkrieg, der in Auschwitz geführt wurde, der eigentlich wichtige Kriegsschauplatz gewesen sei. Ein Klassenkrieg (nicht auch Rassenkrieg?), der zum Zwecke der kompletten Vernichtung der Juden, der Sinti und Roma und anderer geführt wurde – zugunsten der Arier.
Zum kreierten Weltbild der SS gehörte auch eine Ästhetik. Niemand sollte unterschätzen, welche Rolle diese Ästhetik gespielt hat. Dazu gehörten diese albernen Sinnsprüche, wie „Arbeit macht frei“. Eines Tages erhielten Häftlinge den Befehl, dieses Schild „Arbeit macht frei“ zu schmieden. Häftlinge, die teilweise zum ersten Transport gehörten, sind also, wenn man so sagen will, alte Hasen, die die perfiden SS-Schikanen von allen Seiten kennengelernt haben. Sie wissen genau, dass dieser Satz eine Verhöhnung und Erniedrigung ist. Sie schweißten den Satz und drehten das B um. Sie wollten damit zeigen, dass die Welt Kopf steht. Ich glaube nicht, dass das eine konzertierte Widerstandsaktion war, denn sie hatten Angst, als sie das Schild zum Lagertor schleppten und anmontierten. Angst davor, dass die SS-Männer das umgedrehte B erkennen würden und es dann schwere Strafen zur Folge hätte.
Aber es passierte nichts. Die SS-Schergen erkannten den Fehler nicht. Sie waren so von sich eingenommen, dass ihnen der Gedanke zu einem solchen Widerstand überhaupt nicht kam. Diese Geschichte verbreitete sich in Auschwitz schnell unter den Häftlingen. Es war für sie ein Hoffnungsstrahl, wenn sie jeden Tag unter dem Tor durchmarschieren mussten.
Meine Frau hatte die Idee für eine kleine Skulptur, die wir an Politiker und Personen überreichen, die sich gegen rechts und für Menschlichkeit engagieren.
Wer ist bisher ausgezeichnet worden?
Viele. Angelika Merkel, Walter Steinmeier, Wolfgang Schäuble oder Papst Franziskus, um einige zu nennen.
Besonders hat mich bei der Übergabe 2011 der ehemalige UN-Generalsekretär Ban Ki-moon beeindruckt. Er hat emotional das „Die Welt stand Kopf“ sofort umgesetzt und erkannt, dass „alle menschlichen Werte auf dem Kopf standen.“ Das hat er in vielen Reden gesagt, wenn er das B mitgenommen und gezeigt hat als Symbol für einen solchen Ort menschlicher Niedertracht und menschlichen Versagens.
Es gibt aber auch eine große Skulptur...
Also, es gibt sie als Skulptur, die um die Welt wandert. Die steht im Moment auf dem Parkplatz in Birkenau. Fünfeinhalb Tonnen schwer. Sie stand schon in Kassel bei der Documenta oder in Brüssel. Paris, Krakau und Warschau haben Interesse gezeigt. Mal sehen, wo das umgekehrte B demnächst stehen wird.
Vor dem Gebäude der Vereinten Nationen in New York ...?
... Das wäre ein Traum.
Was empfinden Sie denn persönlich, wenn jemand den Holocaust leugnet, relativiert oder als Vergangenheit abtut?
Das schwebt zwischen Wut und Bedauern. Es gibt solche Dummbeutel, die einfach in diese klassischen Muster verfallen mit dem „Es muss doch irgendwann mal Schluss sein.“ Das Argument wurde schon 1955 immer wieder vorgebracht. Da hatte eine Aufarbeitung noch nicht einmal angefangen. Für diese Menschen habe ich eigentlich mehr Bedauern übrig.
Wütend werde ich bei Menschen, wie der Herr Höcke. Der weiß ganz genau, auf welcher Klaviatur er spielt. Allerdings sage ich auch, ich muss diese Wut öffentlich zügeln und – wenn überhaupt – dann sehr gezielt einsetzen.
Genau das könnte aber auch das Problem sein. Zeige ich meine Wut oder mein Unverständnis wenig oder gar nicht, erreiche ich auch die, die es eigentlich betrifft, nicht. Oder nur die, die immer wieder sagen: „Es wird schon nicht so schlimm werden.“ Das ist doch eine Gratwanderung ...
... Wissen Sie, Herr Pfundtner, ich finde, es gibt positive Ansätze einer neuen Ehrlichkeit, die sich mittlerweile schärfer akzentuiert. Nehmen Sie die Wahl eines AfD-Kandidaten zum Bundestagsvizepräsidenten. Die können noch so viele Kandidaten aus ihrer Fraktion antreten lassen, sie werden keine Mehrheit finden. Und das ist richtig. Weil diese Leute den Parlamentarismus letztendlich verachten. Das weiß auch jeder und scheinbar sind die anderen – ihrem Gewissen verpflichteten – Abgeordneten bereit, sich nicht mehr an alte Spielregeln zu halten, sondern nehmen ihre Verantwortung ernst. Auch ich nehme die AfD ernst. Und die Partei muss sich ernst nehmen lassen. Wenn ich dann kluge Kommentare von Journalisten lese, die sich darüber echauffieren, dass die Staatsverdrossenheit wächst, weil die AfD keinen Vizepräsidenten bekommt. Obwohl es der Partei angeblich zusteht. Dann kann ich nur zynisch antworten: „Es ist schön, wenn wir dann auch einen AfD-Vizepräsidenten haben, wenn sie die Ersten an die Laternen hängen.“
Sollte jeder Jugendliche Auschwitz gesehen haben?
Da mache ich unterschiedliche Erfahrungen. Das ist so wie mit gefühlter Wärme oder Kälte. Viele junge Frauen und Männer, die zu uns in die Internationale Begegnungsstätte Auschwitz kommen, haben sich oft nur sehr marginal mit dem Thema beschäftigt. Sehr oft fällt auch hier der Satz: „Wir können es nicht mehr hören. Ob im TV oder Radio, immer nur Nazis, KZ oder Judenvernichtung.“
Dennoch rufen wir in den Gesprächen grundsätzliche Dinge, die letztlich Auschwitz und die anderen Vernichtungslager überhaupt erst möglich gemacht, noch einmal ins Gedächtnis zurück. Damit die klar sind, als Voraussetzung für die Zeit hier. Wenn Sie das richtig anpacken, bleibt bei den jungen Menschen zwar die zeitliche Distanz, aber es wächst kein Desinteresse. Wenn Sie es richtig anpacken!
Wie machen Sie das?
Indem ich immer wieder darauf Bezug nehme, dass Geschichte keine Schublade ist, die ich je nach Bedarf öffne oder schließe. Geschichte ist ein kontinuierlicher Prozess, an dem ich auch beteiligt bin. Ich bin ein Teil der Geschichte, die sich mit mir fortsetzt. Wenn den jungen Menschen das klar wird, beginnen sie zu fragen und erwarten Antworten. Von mir. Ihrer Familie. Freunden oder Bekannten. So wird Geschichte spannend. Das erfahren wir, wenn Jugendliche hier über ihre Familie erzählen und wissen wollen, was die während des Dritten Reichs gemacht haben. Besonders, wenn sie den Verdacht haben, sie seien in der SS oder in Lagern eingesetzt gewesen.
Volkswagen ist ein wichtiger Partner der Begegnungsstätte. Wie kam es dazu?
Ganz einfach. Wir brauchten 1986 finanzielle Unterstützung, da der Bau ins Stocken geraten war. Wir hatten schlicht und einfach kein Geld mehr. Der ehemalige Oberbürgermeister von München, Hans Jochen Vogel, ein wahrhaft aufrechter und guter Mensch, hat uns unterstützt und den ehemaligen Arbeitsdirektor von VW gefragt: „Könnt Ihr da nicht helfen?“ Das war zu einer Zeit als VW unter Druck geriet, denn in der Öffentlichkeit und in der Politik wurde damals heftig über die Frage der Entschädigung von Zwangsarbeitern diskutiert und diese eingefordert. Davon war natürlich auch Volkswagen betroffen. Das war also eine gute Gelegenheit für VW, uns zu unterstützen und zu argumentieren, wir engagieren uns doch für die Zukunft, für die freundliche Begegnung junger Menschen an einem sensiblen Ort. Ich sage aber auch ehrlich, mittlerweile hat sich daraus eine hervorragende Zusammenarbeit entwickelt.
Inwiefern?
Ich habe, nachdem die Jugendbegegnungsstätte eröffnet war, mit dem Gesamtleiter für die Ausbildung bei VW gesprochen und ihm vorgeschlagen, uns Auszubildende zu schicken. Daraus ist ein 14-tägiges-Seminarprojekt entstanden, das bis heute läuft. Die jungen Leute arbeiten vormittags in der Gedenkstätte, tragen – wo immer sie gebraucht werden – zur Erhaltung der Gedenkstätte bei. Zum Beispiel beim Neuziehen des Stacheldrahtes. Der muss immer erhalten bleiben, damit alle Besucher wissen, dass dieses Gelände keine grüne Oase, sondern ein Vernichtungslager war. Oder sie helfen bei der Konservierung von Schuhen oder Kleidung der Ermordeten. Mittlerweile sind die jungen Volkswagen-Mitarbeiter für die Gedenkstätte – mit Blick auf das Übermaß der anstehenden Arbeiten – wirklich eine unverzichtbare Hilfe. Es ist eine Arbeit mit jungen Menschen, die VW nicht an die große Glocke hängt und deshalb damit auch keinerlei Öffentlichkeitsarbeit betreibt. (Immerhin gab es in diesem Juni einen Zeitungsartikel über Rathausempfang und im Sommer/Frühjahr eine TV-Reportage über das Projekt.)
Engagieren sich auch andere Unternehmen, die Zwangsarbeiter beschäftigt haben?
Außer einmal im Jahr Thyssen-Krupp, niemand.
Auch die nicht, die Entschädigungen gezahlt haben?
Nein. Die haben sich ja freigekauft ...
Wie bitte ...?
Ein Scherz. Natürlich kann sich niemand von seiner Schuld freikaufen. Deshalb unterstützen viele Unternehmen auch heute noch viele Projekte gegen das Vergessen. Allerdings, wenn ich dann die Begründungen für das Engagement höre, muss ich mir oft hart auf die Lippen beißen. Zum Beispiel, die Deutsche Bahn. Sie lässt Züge nicht über ihre Gleise rollen, die Ausstellungs-Material über die Reichsbahn im Dritten Reich transportieren. Gleichzeitig unterstützen sie den Erweiterungsbau von Yad Vashem mit einem hohen Betrag und brüsten sich damit. Das ist doch Irrsinn.
Trotzdem kommt auch hier etwas in Bewegung, wie zum Beispiel der Fußballverein Borussia Dortmund beweist.
Wieso?
Nicht nur, dass sie sich knallhart von Rechten und Rassismus abgrenzen. Nein, sie kommen auch mit Fans zu uns zur Gedenkstätte. Das begann, als sich europaweit in den Stadien bei der Begrüßung des Gegners dieses Geräusch von ausströmendem Gas wabernd ausbreitete. Und die ganzen rechten Sprüche. Dagegen geht Borussia Dortmund kompromisslos an, das hat sich mittlerweile auf die ganzen anderen Fanclubs in der Bundesliga erstreckt. Das ist sehr gut.
Dazu kommt, Borussia Dortmund forscht in Auschwitz, was aus ehemaligen jüdischen Gründungsmitgliedern und Spielern geworden ist.
Internationale Jugendbegegnungsstätte Oświęcim /Auschwitz
Volker von Törne, deutscher Dichter und damals Geschäftsführer der Aktion Sühnezeichen hatte die Idee einer Jugendbegegnungsstätte in Auschwitz. Bis in die frühen 80er-Jahre war der Bau höchst umstritten, aber dank des Einsatzes und der Unterstützung ehemaliger Häftlinge der Konzentrationslager Dachau, Stutthof, Buchenwald und Auschwitz kam es im Dezember 1985 zu einem positiven Wendepunkt in den Verhandlungen. Besonders Alfred Przybylski, einstiger Häftling Nr. 471 des KZ Auschwitz und Vertreter des Verbandes Polnischer Architekten, unterstützte die Pläne des Architekten Helmut Morlok und trug so maßgeblich zur Realisierung des Projektes bei.
Im Mai 1986 erfolgte der erste Spatenstich.
Am 7. Dezember desselben Jahres erfolgte die feierliche Übergabe des ersten Teils der Jugendbegegnungsstätte. Helmut Morlock sagte damals: „Die Aufgabe, in Oświęcim einen Begegnungsort für Jugendliche verschiedener Nationen der Welt zu planen und zu bauen, war für mich und meine Kollegen ein Geschenk und eine Verpflichtung; ein Geschenk, weil ich diese Aufgabe, die nie schriftlich formuliert und erst recht nicht in Form eines Vertrags festgehalten worden war, als eine Form von Herausforderung, als Berufung angenommen und verstanden habe; ein Geschenk, weil ich die Möglichkeit hatte, meine berufliche Erfahrung, politischen Überzeugungen und meinen christlichen Glauben einzubringen.“ Im Oktober 1998 wurde dann das gesamte Projekt abgeschlossen. Heute ist die Begegnungsstätte im Bewusstsein der Bürger der Stadt und der jungen Besucher aus der ganzen Welt ein Ort mit einer außergewöhnlichen Atmosphäre und ein unverzichtbarer Bestandteil der Gedenkstätte.
Was war Ihr schönstes Erlebnis?
Das schönste Erlebnis ist immer der Erlebensgenuss der Überlebenden. Die Lebensfreude. Der sich in vielen Verhaltensweisen speist, aus ihren Erinnerungen und Erfahrungen. Beispielsweise: Das Teilen. Viele Auschwitzüberlebende essen immer gemeinsam. Von allen Tellern. Das ist gewöhnungsbedürftig, aber hat schon was. Ich werde nie den weit aufgerissenen (überaus erstaunten) Gesichtsausdruck meiner Frau vergessen, als sie sich in Jerusalem ein Stück Torte bestellt hatte und plötzlich sah, wie fünf Gabeln auf ihr Stück niedergingen, so dass nur wenig für sie blieb. So wird gegessen und genossen. Das entspricht natürlich den Erfahrungen, langsam zu genießen, nichts auf dem Teller zu lassen.
Oder, Freundschaft genießen. Immer wieder sich auch gegenseitig seiner selbst zu versichern, der Freundschaft. Das alles ist etwas, was doch im Auschwitzkomitee und unter den Überlebenden eine ganz wichtige Rolle spielt.
Was erschüttert Sie?
Das ist immer die Wehmut, angesichts der Tapferkeit der Überlebenden dem Leben gegenüber. In Chemnitz lebt Justin Sonder, Überlebender von Auschwitz. Nach der Befreiung am 27. Januar 1945 durch die Rote Armee kehrte er zu Fuß sofort über Bayern in seine Heimatstadt zurück und lebt dort bis heute. Im Oktober wird er 95. Mehr als 500 Veranstaltungen mit tausenden Schülern hat er bis heute absolviert. 2016 reiste er als Nebenkläger nach Detmold, um im wahrscheinlich letzten großen Auschwitzprozess gegen einen ehemaligen Wachmann des Vernichtungslagers auszusagen. Mit Wehmut meine ich: 2017 wurde er Ehrenbürger von Chemnitz – mit Stimmen der AfD. Was muss in dem Menschen vorgehen, wenn er sieht, wie sich die Koordinaten jetzt wieder verschieben. Wenn schon die AfD Deutungshoheit beansprucht über die Geschichte, die ihn so sehr erniedrigt hat.
Womit hat bei uns die Auseinandersetzung begonnen? Ich sage mit der amerikanischen Fernsehserie „Holocaust“.
Ja, wahrscheinlich ist das die Zäsur gewesen.
Brauchen wir eine neue Verfilmung?
Vielleicht nicht unbedingt eine neue Verfilmung. Aber eine neue Rezeption. Vieles, was im Moment geschieht, geschieht in diesem unsäglichen Mainstream der Verschiebung der Werte. Nehmen Sie das Buch „Stella“ von Takis Würgers. Es gab eine junge Jüdin, die andere Juden ans Messer geliefert hat, weil ihr die Nazis vorgaukelten, so könne sie ihre Familie retten. Was natürlich gelogen war. Eine menschlich unglaublich berührende Geschichte. Wenn ich dann ein sensationsheischendes Buch daraus mache, ist das für mich zumindest äußerst fragwürdig.
Was ist Ihr großes Ziel, Ihre Vision?
Schwierige Frage. Das ist eigentlich eine Vision des Alltäglichen. Ich hätte gerne mehr Zeit zum Schreiben. Und auch mehr Zeit, die Dinge aufzuschreiben, die sich in dem Zusammenhang mit dem, was ich hier in Auschwitz und in der Jugendbegegnungsstätte erfahre, ereignen. Also das, was ich sehr viel bei Führungen junger Leute an Erinnerungen gesammelt habe. Und das, was die Überlebenden mir erzählt haben. Das ist mir wichtig.
Gibt es irgendetwas, woran Sie verzweifeln können?
Nicht wirklich, nein. Aber was mir oft Probleme bereitet: Wir reden zu wenig miteinander. Wir müssen mehr miteinander reden. Mit unseren Nachbarn, mit Menschen anderer Nationalität, anderer Religion. Nur über den persönlichen Austausch und nur mit Toleranz und Offenheit wird es uns gelingen, einen neuen Holocaust zu verhindern.
Lesen Sie zu dem Thema auch das Gespräch mit Zoni Weisz: Ich werde immer mit dem Holocaust leben müssen.
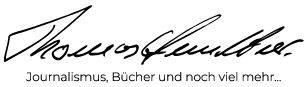




Hinterlasse einen Kommentar